(Heinrich Heine; vgl. Clausberg 1990, S. 5)
INHALT
1. Eine Einführung
2. Deutschlands langer Weg nach Lakehurst
2.1. Die Pionierzeit unter Ferdinand von Zeppelin (Zweites Reich - Monarchie)
2.2. Deutschland baut auf Hugo Eckener (Weimarer Republik - Demokratie)
2.3. Die Nazis zeigen Flagge am LZ 129 (Drittes Reich - Diktatur)
3. Das Geschehen vom 6. Mai 1937
3.1. Ansichten zum Hergang bei den Zuschauern
3.2. Auffassungen beim Personal
3.3. Der schwierige Standpunkt von Hugo Eckener
3.4. Die Ergebnisse der Untersuchungskommissionen
3.5. Neuere Ansichten
3.6. Eigener Standpunkt
4. Die unerwarteten Folgen für die Nazis
5. Ein Fazit
1. Eine Einführung
Der Untergang des Zeppelin-Luftschiffes LZ 129 „Hindenburg" kurz vor dem Festmachen in Lakehurst (USA) am 6. Mai 1937 (2 Jahre vor dem Beginn und 8 vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs) hat sich wie kaum ein anderes Ereignis des 20. Jahrhunderts (dem „amerikanischen" nach einem mehr englischen) vor dem Attentat auf das World Trade Center in New York (gleichfalls USA) im September 2001 (also schon im wohl „chinesischen" 21. Jahrhundert - siehe
 ) in das Bewußtsein unserer Zivilisation eingebrannt.
) in das Bewußtsein unserer Zivilisation eingebrannt.[Nachtrag vom 9. Januar 2006: Zum ,amerikanischen 20. Jahrhundert' siehe jetzt Harm G. Schröter, Americanization of the European Economy. A Compact Survey of American Economic influence in Europe since the 1880s, Dordrecht 2005; dazu gibt es eine Besprechung von Arndt Christiansen in der F. A. Z. vom 9.1.2006 (S. 12)]
Gleichwohl ist das weiter Zurückliegende der beiden erwähnten Ereignisse trotz wiederholter und teils sehr detaillierter Forschungen noch längst nicht abschließend untersucht und aufgeklärt worden.
Da der allgemeine Untergang der Großluftschiffe im Übergang zum Zweiten Weltkrieg heute noch gewisse Lähmungserscheinungen in der deutschen Politik erkennen läßt - denn es entstand mangels hinreichender Förderung noch kein neues Fracht- oder Passagierluftschiff früherer Größe oder entsprechend heutiger Möglichkeiten -, halte ich es weiterhin für wichtig, zur Aufklärung des im Titel genannten Ereignisses beizutragen.
Vielleicht sieht man dann den Umgang der heutigen Justiz und Politik mit der CargoLifter-Aktiengesellschaft und diesbezüglichen Initiativen in einem etwas anderen Licht.
Hinsichtlich der Vernichtung des LZ 129 stehen zwei Auffassungen im Vordergrund:
1. eine Zerstörung mittels einer „Höllenmaschine", angebracht im Bereich der Gaszelle 4 im hinteren Teil des Zeppelins, durch Nazi-Gegner,
2. eine Entzündung durch ein Elmsfeuer oder eine sonstige funkenfähige Entladung an der Außenhaut nahe der oberen Schwanzflosse
Gegenüber diesen beiden Theorien darf aber wohl eine dritte Möglichkeit nicht ohne Weiteres von der Hand gewiesen werden, welche in etwa der ersten entspricht, aber einen anderen Täterkreis und ein anderes, naheliegenderes Motiv beinhaltet. Sie unterstellt, daß der Brand im Interesse und auf Betreiben der deutschen Machthaber entstanden oder zumindest beeinflußt worden ist, wobei sich die Tat allerdings anders entwickelte als der Plan. Dieser hätte sich zunächst günstig entwickelt, weil vor dem Abflug sogenannte „Sicherheitsbeamte" an Bord gelangten, um angeblich nach einer Zeitbombe zu suchen; diese dürfte dabei leicht zu installieren gewesen sein.
Die Wirkung der Verbrennung des Luftschiffs (vor einem zahlreichen Publikum mit einigen Vertretern der internationalen Presse) wäre dann jedoch eine andere als die von den Machthabern wohl erwartete gewesen. Zwar wurde klar, daß das Ausmaß des Unglücks auf den als Traggas verwendeten Wasserstoff zurückzuführen ist und dieser durch einen nichtbrennbaren Stoff ersetzt werden könnte. Tatsächlich wurde den Nazis zunächst seitens der USA als Inhaber des Weltmonopols als Ersatz für den gefährlicheren Wasserstoff Helium versprochen (um welches es den deutschen Kriegstreibern vorrangig gegangen sein dürfte), doch zog man diese Genehmigung später wegen des deutschen Einmarsches in Österreich wieder zurück, womit Helium als kriegswichtiger Grundstoff für Deutschland im Zweiten Weltkrieg ausfiel.
Nach dieser neuen Theorie starben die Opfer des Zeppelin-Brandes in Lakehurst einen grausamen, letztlich sinnlosen Tod ganz wie die Betroffenen der „World Trade Center-Katastrophe", welche gleichfalls auf terroristischen Methoden zur Durchsetzung politischer Ziele in Friedenszeiten basierte, aber im Rahmen der Entwicklung unserer Zivilisation einen neuen Höhepunkt darstellt, weil sie warnungslos erfolgte und neben den Tätern tausenden Unschuldigen das Leben kostete. Hinsichtlich der Medienwirksamkeit und der politischen Folgen stellen beide Katastrophen vergleichbare Ereignisse dar.
2. Deutschlands langer Weg nach Lakehurst
2.1. Die Pionierzeit unter Ferdinand von Zeppelin (Zweites Reich - Monarchie)
Graf Ferdinand von Zeppelin (*1838 - †1917) beschäftigte sich seit seiner Verabschiedung als preußischer Generalmajor lange Zeit ohne sichtbare Erfolge mit der militärisch wichtigen Luftschiff-Frage; er war angesichts ihrer Bedeutung sogar bereit, zur Entwicklung aus seinem privaten Vermögen entscheidend beizutragen, und auch „sein Wille gab ihm die Kraft, neue Wege zu finden" (Wittemann 1925, S. 13). Trotz vieler Enttäuschungen gelang ihm im Jahr 1898 mit Unterstützung eines Vereins deutscher Ingenieure (Wittemann 1925, S.10) die Gründung einer Aktien-„Gesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt", welche in gewisser Weise eine Vorläuferin der heutigen CargoLifter AG darstellte (vgl. die CargoLifter-Katastrophe). Im Gegensatz zur letztgenannten Firma wurde seinerzeit bereits im Folgejahr mit dem Bau eines Prototyps begonnen, bezeichnet als LZ 1 (Meyer 1980, S. 17, Sp. 1). Selbstredend gab es ernste Schwierigkeiten mit den ersten, kaum zu bändigenden Giganten, doch der Graf erwies sich trotz aller Rückschläge als ein guter Dresseur, welcher persönliche Verluste zu Gunsten eines allgemeinen Gewinns hinzunehmen bereit war. Nachdem die deutsche Militärverwaltung die Übernahme des LZ 1 verweigerte, stand man zunächst einmal - ähnlich wie heute die CargoLifter AG - vor dem finanziellen Ruin (welcher zur Auflösung der AG führte). Der Verlust des zweiten Prototypen LZ 2 im Januar 1902 (Meyer 1980, S. 20) trug an sich nicht zur Verbesserung der Situation bei. Immerhin vermochte damals - noch zu Zeiten der Monarchie - trotz der wiederkehrenden, geradezu erschütternden Pannen ein (um nicht zu sagen: der) Graf das böse zugerichtete Projekt immer wieder aus den Dreck zu ziehen.
Auf der Grundlage einer - nach dem Versagen bei Deutschlands Politik und Militär - nicht unerheblichen Volksspende (bei der selbst Kinder für eine hoffnungsvolle Zukunft ihre Spardosen leerten - vgl. Wittemann 1925, S. 17; zur Volkstümlichkeit der frühen Zeppeline siehe auch Marx 1959, S. 34 f) wurde schließlich am 8. September 1908, mehr als ein Vierteljahrhundert vor der Zerstörung des LZ 129 „Hindenburg", die Firma „Luftschiffbau Zeppelin GmbH" (LZ) mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee gegründet. Hauptgesellschafter derselben wurde die Zeppelin-Stiftung unter dem Vorsitz des Grafen Zeppelin; zum Geschäftsführer wurde Dr. ing. h.c. Alfred Colsman berufen (Wittemann 1925, S. 18; Clausberg 1990, S. 60). Im Spätherbst 1909 folgte auf dessen Anregung hin die Gründung der DELAG - „Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft" - mit Sitz in Frankfurt am Main (Clausberg 1990, S. 65 f; Treibel 1992, S. 165); dabei handelte es sich um ein Transportunternehmen ähnlich der Deutschen Lufthansa AG, welche ja auch einmal klein anfangen mußte (heute freilich ist sie so ausgewachsen, daß die alte Dame etwa einer Verbindung ihrer Tochter Lufthansa Cargo mit CargoLifter entschieden begegnen kann). Angesichts des Zauderns bei der deutschen Militärverwaltung bedeutete die Fertigung von Passagier-Luftschiffen die Rettung des Zeppelin-Baus. Anton Wittemann meinte im Jahr 1925 anerkennend zur Intiative der DELAG: „Harmlos fast und mit mutigem Vertrauen auf die Trefflichkeit der Schiffe begab man sich in das unsichere Element." (Wittemann 1925, S. 18). Der Begriff „Schiff" ist hier fast wörtlich zu nehmen, denn die ersten Zeppeline unternahmen ja zunächst noch Wasserlandungen (bei der ersten Zeppelin-Werfthalle auf dem Bodensee bei Manzell). Starts und Landungen auf dem Wasser waren übrigens auch - nicht zuletzt wegen der Ballastaufnahmemöglichkeit - für das nicht realisierte sogenannte „Wasserluftschiff" WL 1 nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen (siehe Jäger 1956).
Der LZ 7 „Deutschland" der DELAG - das erste Passagier-Luftschiff überhaupt - wurde im Juni 1910 in dem klimatisch günstigen Düsseldorf am Niederrhein stationiert, wo die Stadt „die erste Stätte dem werdenden Luftverkehr bereitet hatte", wie es einst Anton Wittemann formulierte (Wittemann 1925, S. 19; vgl. Treibel 1992, S. 127, Sp. 1). Nach erfolgversprechenden Unternehmungen strandete der LZ 7 - und beinahe auch die DELAG selbst - (wie schon die niederrheinische Armee des legendären Kaisers Augustus neunzehn Jahrhunderte zuvor) im schönen Teutoburger Wald (Wittemann 1925, S. 18). Es wurde durch LZ 8 (Meyer 1980, S. 30, Sp. 1) ersetzt (während sich die geschlagene Römertruppe keiner wirklichen Nachfolge erfreuen durfte). Auch das deutsche Heer genoß noch wenig Freude mit ihren letztlich doch erworbenen Zeppelinen, und so ergab die Strandung des LZ 5 (Z II) im April 1910 bei Weilburg an der Lahn auch keine schönen Bilder (Meyer 1980, S. 27). Die Unfälle konnten übrigens selbst einen entschiedenen Gegner der Zeppeline, wie es ein gewisser Dr. Hugo Eckener zunächst war, nicht davon abhalten, im Jahr 1908 seine Arbeitskraft der LZ bereitzustellen.
Die Havarie des LZ 7 mag übrigens später Adolf Hitler mit dazu bewogen haben, eines seiner Kriegsschiffe in „Lützow" umbenennen zu lassen, denn „Deutschland" - so meinte er (ähnlich wie Arminius anno 9 im besagten Wald) - dürfe nicht untergehen; schließlich untergräbt ein solcher Vorgang die Moral (alte Römer wissen's schon). Die Zeppeliner freilich ließen sich von solchen originellen Ideen nicht beirren und zeigten schon im Jahr 1910 ihre Vorliebe für Namenswiederholungen: sie tauften den LZ 8 „Deutschland" wie schon das untergegangene Objekt. Es dauerte nun nicht länger als bis zum Mai 1911, daß auch LZ 8 havarierte; diesmal geschah dies allerdings an der Luftschiff-Betriebshalle im Flughafen zu Düsseldorf (Meyer 1980, S. 30, mit Abb. auf S. 31; Knäusel 1988, Foto auf Deckblatt; Clausberg 1990, S. 209, Abb. 60 - 61; das Unglück von Düsseldorf zeigte nach Wittemann 1925, S. 21, „daß die Zeppelin-Frage nicht zum mindesten eine Hallenfrage geworden war"). Selbst dieser Vorfall minderte die Popularität der Zeppeline um keinen Zoll, denn es kam ja weder zu einer Explosion noch zu einem auch nur einzigen Todesfall unter den Passagieren - so blieb Raum für Anekdoten (vgl. Knäusel 1988, S. 25; zur Entwicklung der Zeppeline bis zum Ersten Weltkrieg aus zeitnaher Sicht siehe Wittemann 1925, S. 8 - 25 u. 30), während später, nach dem Brand des LZ 129, Angst und Tränen dominierten (Göring 1937, Sp. 2 f). Einer der Hauptgründe für die Unfälle der Pionierzeit war - neben der schlechten Wettervorhersage (die einst schon den Römern zu schaffen gemacht haben dürfte) - die unzureichende Motorik, und daher wurde mit Hochdruck an stärkeren und zuverlässigeren Antriebsmaschinen gearbeitet. Auf Anregung von Karl Maybach entstand in Friedrichshafen die Motorenbau GmbH, und bald erfreuten sich die Maybach-Motoren großer Beliebtheit unter den Luftschiff-Konstrukteuren (Wittemann 1925, S. 19).
Noch im Jahr 1911 stellte sich endlich der Erfolg der Zeppelin-Luftschifffahrt ein, denn in der zweiten Jahreshälfte unternahm der LZ 10 „Schwaben" - nach Treibel 1992, S. 127, Sp. 1, in Düsseldorf stationiert, später in Baden-Baden (Baden-Oos) - 130 Fahrten an etwa gleichviel Tagen, welche „vom Vierwaldstättersee bis Hamburg, von Berlin bis Düsseldorf gingen" (Wittemann 1925, S. 22). Insgesamt kam der LZ 10 in einjähriger Einsatzzeit auf etwa 29.000 Kilometer und auf 234 Fahrten mit zusammen mehr als 4.500 Fahrgästen (Treibel 1992, S. 127, Sp. 1). Nach Anton Wittemann „war es der Delag vergönnt", vor (im Gegensatz zu den Verhältnissen nach) dem Ersten Weltkrieg mit den Passagierluftschiffen LZ 11 „Viktoria-Louise", LZ 13 „Hansa" und LZ 17 „Sachsen" glänzende Fahrten zu unternehmen, welche auch „weit in See hinausführten" (Wittemann 1925, S. 24). Fragen der Aerodynamik fanden übrigens erst später, schon im Ersten Weltkrieg, gebührendes Interesse, als man sich in der Form den gleichfalls beliebten Holzgerüst-Luftschiffen der Marke Schütte-Lanz annäherte (vgl. Meyer 1980, S. 107; Clausberg 1990, S. 218; Zeppelin-Schattenrisse bei Bock et Knauer 2003, S. 228). Letztere konnten sich übrigens schon deshalb nicht durchsetzen, weil ihr Gerippe reperaturanfälliger war als das Duralumin-Skelett der Zeppeline (Meyer 1980, S. 107; zum Duralumin-Gerüst siehe Wittemann 1925, S. 34).
Mit dem Erfolg der Passagier-Zeppeline gewann auch das Militär wieder Vertrauen zu den grauen Giganten. Der Erste Weltkrieg führte zwar zu einem Zeppelin-Bauboom (vgl. Marx 1959, S. 36; Meyer 1980), aber angesichts der Verwundbarkeit dieser Militärfahrzeuge auch zu ungewöhnlich hohen Verlusten an Menschenleben; E. Marx resümierte: „Etwa 100 [Zeppeline] waren es, die fast alle nutzlos ein Opfer des Molochs Krieg wurden." (Marx 1959, S. 36, Sp. 1; zur Entwicklung der Zeppeline im Ersten Weltkrieg aus zeitnaher Sicht: Wittemann 1925, S. 25 - 30) - Graf F. v. Zeppelin hat die völlige Vernichtung der Kriegszeppeline nicht mehr miterleben müssen, denn er starb im März 1917.
2.2. Deutschland baut auf Hugo Eckener (Weimarer Republik - Demokratie)
Schon im 1920er Jahrzehnt wurde klar, daß auf der ganzen Welt neben den Zeppelinen kein zweites Verkehrsmittel existierte, welches Passagiere auch nur annähernd so schnell, zuverlässig und bequem von einem Kontinent zum anderen hätte bringen können; hinreichend schnelle und zuverlässige Dampfer waren auch Jahre nach dem Untergang des Ozeanriesen „Titanic" noch nicht in Sicht, und an schnelle und zugleich bequeme Passagierflugzeuge denkt man selbst heute noch zu wenig. Immerhin vermochten diverse Pionierleistungen - wie etwa die erste Weltmeerpassage eines Luftschiffes, und zwar des englischen R 34 im Juli 1919 (Botting 1993, S. 74 - 79), oder der Atlantik-Alleinflug von Charles A. Lindbergh (*1902 - †1974) im Mai 1927 - auch Interesse in dieser Richtung zu wecken. Einzig das Gerüstluftschiff der Marke Zeppelin wies währenddessen in der es verkörpernden Größe, Ruhe und Reichweite allen nicht zu hoch strebenden Visionen einen gangbaren Weg, während die englischen und amerikanischen Modelle sich als unsicher erwiesen. Spätestens die aufsehenerregende Weltumrundung im Sommer 1929 (Meyer 1980, S. 125 - 127; Botting 1993, S. 109 - 122; Geisenheyner 1997) machte die Zeppeline zu höchstpopulären und - zumal bei den modern denkenden Amerikanern - begehrten Erscheinungen im In- und Ausland (Clausberg 1990, S. 18).
Nach dem im Ersten Weltkrieg erfolgten Tod des für die Pionierzeit zuständigen Grafen F. v. Zeppelin fand sich auch jetzt - in der Entwicklungszeit - eine Persönlichkeit, welche Wille und Weg in hervorragender Weise zu verkörpern vermochte. Schon der Besuch in den USA im Herbst 1928 (Meyer 1980, S. 122 - 124) und eine Arktisfahrt im Sommer 1931 (Meyer 1980, S. 128 - 130; Koestler 1997), welche jeweils mit dem LZ 127 „Graf Zeppelin" erfolgten, beförderten nicht nur kostbare Fracht und eben solche Passagiere, sondern sie förderten vor allem den Ruhm des diese Unternehmungen leitenden Konzernpräsidenten Dr. Hugo Eckener (*1868 - †1954), welcher sich schon mit seiner zu Reparationszwecken erfolgten Transatlantik-Überführungsfahrt - die sogenannte „Amerikafahrt" - nach Lakehurst mit dem LZ 126 (amerikanisch ZR 3 „Los Angeles"; zum LZ 126 siehe Wittemann 1925, S. 33 ff) im Oktober 1924 einen Namen gemacht hatte (zur "Amerikafahrt" siehe Wittemann 1925, S. 101 - 119), als er wegen unerhörter Prämienforderungen der in Frage kommenden Versicherungen die Reise selbst verantwortete und dabei mit dem gesamten Kapital des ihm unterstehenden Konzerns bürgte (Meyer 1980, S. 116 f; zum Überführungsproblem vgl. Marx 1959, S. 36, Sp. 1). E. Marx meinte zum Ergebnis dieser Reise: „Die Flugbahn [sic!] des Luftschiffes wurde zur Brücke zwischen den Herzen zweier Völker, die sich noch kurze Zeit vorher feindlich gegenüberstanden." (Marx 1959, S. 36, Sp. 1 f).
Die Volkstümlichkeit der Firma (LZ) und ihrers Gründers (Zeppelin) übertrug sich dergestalt auf Dr. Hugo Eckener, daß dieser „Europäer im besten Sinne des Wortes" (Marx 1959, S. 36, Sp. 2) als aussichtsreicher Kandidat für das Amt des deutschen Reichspräsidenten (oder Kanzlers) ins Gespräch kam. Letzteres brachte ihm den Haß der Nazis ein, natürlich wegen der damit verbundenen möglichen Konkurrenz zu Adolf Hitler. Nach Ansicht von Douglas Botting schützte H. Eckener nur sein Ruhm vor einer Einweisung in eines der Konzentrationslager, denn er ließ sich durch die Machtergreifung und die daraus resultierende Bevormundung durch die Nazis nur wenig beeindrucken (Botting 1993, S. 148).
Von der Popularität seines Vaters dürfte unter anderem Knut Eckener profitiert haben, indem er als Montageleiter den im Herbst 1931 begonnenen Bau des LZ 129 „Hindenburg" beaufsichtigte (ebd.).
2.3. Die Nazis zeigen Flagge am LZ 129 (Drittes Reich - Diktatur)
Die nationalsozialistische Machtergreifung 1933 hatte gravierende Auswirkungen auf die Organisation der Luftschifffahrt in Deutschland. Dies war äußerlich freilich nicht so leicht erkennbar wie das schon 1934 erfolgende Anbringen von Hakenkreuzflaggen am LZ 127 (Botting 1993, S. 148). Hier spielen mehr Fragen der damals üblichen Gleichschaltung eine Rolle, wobei H. Eckener als geschäftsführender Direktor eines wichtigen Konzerns unmittelbar betroffen war. Am 22. März 1935 gründete nämlich das deutsche „Luftfahrt"-Ministerium in der deutschen Reichshauptstadt Berlin die „Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH" (DZR) mit dem Ziel, die Luftschiffbau Zeppelin GmbH (LZ) von den Aufgaben des Fracht- und Passagierdienstes zu entbinden, da sie sich auf ihre Kernfunktion als Bauwerft konzentrieren sollte (Meyer 1980, S. 156). Hugo Eckener wurde zwar Aufsichtsratsvorsitzender der Reederei, an welcher - neben der LZ - die bereits erwähnte Deutsche Lufthansa AG immerhin zur Hälfte beteiligt war, aber die Posten des Geschäftsführers und des Leiters der Verkehrsabteilung wurden an Ernst A. Lehmann (*1886 - †1937) übertragen, welcher gleichfalls ein erfahrener Zeppelin-Kapitän und bis dahin gewissermaßen Eckeners rechte Hand war (Botting 1993, S. 148). Jetzt ließen sich Spannungen leicht vorausahnen, bei denen E. A. Lehmann sicherlich eher mit politischer Unterstützung rechnen konnte. Bei den Nazis stand Lehmann als „Inhaber zahlreicher Kriegsauszeichnungen" und „Führer zahlreicher Kriegsluftschiffe" in hohen Ehren, hatte er doch im Ersten Weltkrieg die Militärzeppeline LZ 17 „Sachsen", LZ 26 „Z XII", LZ 90 und LZ 98 "L 52" geführt, außerdem unmittelbar nach diesem Krieg den LZ 120 „Bodensee" (N. N. 1937 a; vgl. Bock et Knauer 2003, S. 228 u. 453). Zum Luftschiffbau Zeppelin gelangte er, indem er im Kriegsjahr 1917 dorthin „als Leiter der Bauaufsicht kommandiert" wurde: „Mit Dr. Eckener wirkte er als Lehrer bei der Marineluftschiffabteilung. Von 1920 bis zum vorigen Jahr [1936] hatte er den Posten eines Prokuristen beim Luftschiffbau Zeppelin inne. Von 1923 bis 1927 war Lehmann gleichzeitig Vizepräsident der Goodyear Zeppelin Corporation in Akron (Ohio)." (N. N. 1937 a, Sp. 4) - Die Berufung eines bedeutenden Kriegskapitäns zum geschäftsführenden Direktor deutet vielleicht bereits eine neue nationalsozialistische Politik im Hinblick auf die zukünftige Rolle der deutschen Zeppeline an. Die nicht vorgesehene Mitfahrt im LZ 129 Anfang Mai 1937 und der am Ende der Reise erfolgte Tod von E. Lehmann (7. Mai) mag diesbezüglich - wie auch durch den Verzicht auf Helium - letztlich zu Änderungen bei der Konzeption geführt haben.
Die Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb der Zeppeline standen nunmehr auf einem recht hohen Niveau; beispielsweise wurde der nach wie vor als Traggas dienende Wasserstoff mit knoblauchartig riechendem Duftstoff angereichert, um austretendes Gas leichter aufspüren zu können (Bain et Schmidtchen 2000; vgl. auch Toland 1989, S. 230). Zudem hatte man die Planungen für den LZ 128 (für etwa 33 Passagiere) eingestellt (Botting 1993, S. 145), nachdem im Oktober 1930 in Frankreich (vgl. Botting 1993, S. 130) das britische Gerüstluftschiff R 101 (für 50 Passagiere) verbrannte (Meyer 1980, S. 107; Botting 1993, S. 130, Abb. o. Nr.); diese Konstruktion sah nämlich ebenso wenig wie schon beim LZ 127 eine ersatzweise Befüllung mit Helium vor. Dieses weniger tragfähige, aber ungefährlichere Edelgas wurde dann bei allen Zeppelin-Neubauten als Alternative in die Entwicklung einbezogen (vgl. Botting 1993, S. 145 u. 149), wobei man sich bewußt war, daß wegen des damals bestehenden Weltmonopols als Lieferant allein die USA in Frage kamen, während heutzutage auch Algerien und Rußland über entsprechende Quellen verfügen (Bock et Knauer 2003, S. 58, Sp. 1). Die Vereinigten Staaten zögerten angesichts der politischen Entwicklung in Deutschland verständlicherweise mit einer Herausgabe. Gleichwohl galten die Zeppeline gegen Mitte des 1930er Jahrzehnts als die sichersten Luftbeförderungsmittel der Welt, so daß selbst die Versicherungsfrage - ganz anders als beim LZ 126 anno 1924 - kein Problem mehr darstellte. Für die Versicherungssumme des LZ 129 von einer halben Million britischer Pfund verlangte die britische Lloyds Prämienzahlungen von nur fünf Prozent (Toland 1989, S. 228)!
Die Deutsche Zeppelin-Reederei wurde im Jahr der Olympiade in Berlin mit der Indienstnahme des LZ 129 „Hindenburg", welche nach der erfolgreichen Werkstattfahrt vom 4. März 1936 erfolgte (Meyer 1980, S. 157), zusehens zu einem Weltunternehmen (Meyer 1980, S. 13, Sp. 2). Schon bei seiner ersten Fahrt trug der neue Zeppelin vier Hakenkreuze am Heck (Botting 1993, S. 148), und noch im selben Monat startete er unter dem Kommando von Ernst A. Lehmann - und in Begleitung des LZ 127 - zu seiner Jungfernfahrt quer durch Deutschland; die ganze Unternehmung diente dabei einer nationalsozialistischen Propagandakampagne zur Reichstagswahl vom 29. März (Meyer 1980, S. 158). Hugo Eckener soll über diese politische Vereinnahmung so verärgert gewesen sein, daß er die Jungfernreise als „blödsinnige Fahrt" bezeichnete und sich damit den Zorn des Propagandaministers Dr. Joseph Goebbels zuzog; dieser habe der deutschen Presse prompt untersagt, Eckeners Namen „künftig" auch nur zu erwähnen, und selbst eine Abbildung von ihm dürfe „nicht mehr gebracht werden" (Zitate nach Botting 1993, S. 148; vgl. Archbold 1994, S. 156 u. 158). Diese Regelung bestand allerdings am 7. Mai 1937, dem Tag nach dem Zeppelin-Brand, offensichtlich nicht mehr (Eckener 1937). Eine politische Vereinnahmung des neuen Zeppelins zeigt sich übrigens auch in der Namensgebung, denn der 1934 verstorbene Paul von Beneckendorff und von Hindenburg war nicht nur Oberbefehlshaber des deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg, sondern als Reichspräsident auch Wegbereiter seines Nachfolgers Adolf Hitler im Übergang zur Diktatur.
Den Rest des Jahres 1936 über unternahm der LZ 129 Fahrten nach Nord-, aber auch schon - wie bereits der LZ 127 - nach Südamerika (Meyer 1980, S. 158), wo Deutschland ein hohes Ansehen genoß. Im Amerikadienst des LZ 129 wurden übrigens Pakete bis zu 20 kg Gewicht und einem Meter Länge befördert. An Fracht gab es die verschiedensten Dinge an Bord, vom Kanarienvogel bis zum Sportflugzeug (vgl. Bock et Knauer 2003, S. 25, Abb. 1.2.7), und ein getarnter Brandkörper wäre da wohl kaum aus dem Rahmen gefallen. Die noch nicht sehr zahlreichen Fahrgäste kamen bereits aus allen Winkeln dieser Welt (Meyer 1980, S. 13, Sp. 2). Der Fahrbetrieb wurde - nicht zuletzt wegen der klimatisch und topographisch günstigeren Lage - im Sommer 1936 von Friedrichshafen (am Bodensee) auf den neuen Rhein-Main-Flughafen verlegt (Botting 1993, S. 148; zum Luftschiffhafen siehe Treibel 1992, S. 168 - 171). In Frankfurt am Main war bereits im Jahr 1912 im Auftrag der DELAG eine Zeppelin-Betriebshalle errichtet worden, um dort den LZ 11 „Viktoria-Louise" zu stationieren (Wittemann 1925, S. 22); dieses Objekt am Luftschiff- und Flughafen Rebstock war aber im Rahmen der Nachkriegsreperationen beseitigt worden (Treibel 1992, S. 166, Sp. 2).
Das Jahr 1937 begann vielversprechend; die Deutschen Zeppelin-Reederei erwartete nunmehr - nach jahrelanger Abhängigkeit von Staatsgeldern - den herbeigesehnten kommerziellen Durchbruch. Der LZ 130 „Graf Zeppelin" (II) sollte nach Fertigstellung und Betriebsgenehmigung am 27. Oktober 1937 gleich nach Südamerika starten, und zwar zu einer Jungfernfahrt nach Rio de Janeiro in Brasilien. Neben dem bereits als veraltet geltenden LZ 127 „Graf Zeppelin" (I) sollten nach diesen Plänen zwei schon recht moderne Zeppeline den Interkontinentalverkehr zwischen Alter und Neuer Welt zu neuen Ufern bringen; die Namen von bislang nur wenigen Nichteinheimischen bekannten Örtlichkeiten gingen nun gewissermaßen durch aller Munde. Insgesamt waren für 1937 wenigstens 78 Atlantikfahrten eingeplant (Botting 1993, S. 152).
Diejenige Luftfahrt des LZ 129, welche am 3. Mai in Frankfurt begann, galt noch vorwiegend Ausbildungszwecken. Es befanden sich nur 36 Passagiere, aber 61 Besatzungsmitglieder an Bord, darunter fünf Zeppelin-Kapitäne (Botting 1993, S. 152).Während der LZ 129 für etwa 75 Passagiere gebaut wurde, war der vor seiner Fertigstellung stehende LZ 130 (der neue, also zweite „Graf Zeppelin" - man beachte, mit wieviel Liebe dem Initiator gehuldigt wurde!) für 100, LZ 131 bereits für 150 Reisende ausgelegt (Botting 1993, S. 152), wobei die noch notwendige Verwendung von Wasserstoff statt Helium als Traggas wenigstens hinsichtlich der Transportfähigkeit Vorteile besaß.
3. Das Geschehen vom 6. Mai 1937
Die dreiundsechzigste Fahrt des LZ 129 „Hindenburg" wurde schon vor dem Start von einer Bombenwarnung überschattet, welche von dem am 8. April 1937 geschriebenen Brief einer gewissen Kathie Rauch aus Milwaukee (Wisconsin, USA) an die deutsche Botschaft in Washington, D.C., ausging: „Bitte informieren Sie das Zeppelin-Unternehmen in Frankfurt am Main, daß sie [also nicht etwa „Sicherheitsleute"!] jede Post öffnen und untersuchen sollen, bevor sie diese vor jedem Flug [gemeint: jeder Fahrt] des Zeppelins ,Hindenburg' an Bord bringen. Der Zeppelin wird auf seinem Flug in ein anderes Land zerstört werden." (Übersetzung nach dem Originaltext bei Archbold 1994, S. 172; vgl. Botting 1993, S. 154, wo es weiter heißt: „Nehmen Sie meine Worte bitte als Wahrheit, damit später niemand Grund für Selbstvorwürfe hat."). Der Botschafter Hans Luther war natürlich völlig aufgelöst, als er am Tage nach der Katastrophe Überlebende besuchte (Toland 1989, S. 264). Spätere Untersuchungen sollen ergeben haben, daß die Dame ihre Information von einem Hellseher bezog, welcher den „Hindenburg" im Traum in Flammen aufgehen gesehen habe (Botting 1993, S. 164). Inwiefern der „ominöse Brief" der K. Rauch bloß auf „Befürchtungen eines Okkultisten" beruhte, wie Douglas Botting meinte (Botting 1993, S. 164), oder ein Resultat guter Geheimdienstarbeit war, muß dahingestellt bleiben. Offen ist bei dieser immerhin bemerkenswerten Geschichte auch, wieso als Brandursache „a time bomb" angenommen und ausdrücklich eine Fahrt („flight") in „another country" (also nicht nach Deutschland oder in die USA) als Gelegenheit für ein Attentat empfunden wurde. Die Bombenwarnung hat nach der Katastrophe zu wiederholten Spekulationen über Nazi-Gegner als mögliche Attentäter geführt (siehe dazu Toland 1989, S. 266, Anm. 2), während es trotz Reichstagsbrand, Röhm-„Putsch" und Pogromnacht - von den Konzentrationslagern und den Morden an Hilflosen („Euthanasie") ganz zu schweigen - offenbar bis heute als unvorstellbar erscheint, daß die Zeppelin-Katastrophe von führenden Angehörigen des Nazi-Regimes selbst geplant worden sein könnte.
Während der ganzen Atlantikfahrt - vor der Ankunft in Amerika - war die Stimmung an Bord gedrückt (Archbold 1994, S. 174). Ernst Lehmann, welcher erst vor wenigen Wochen seinen einzigen Sohn verloren hatte (Archbold 1994, S. 174, Sp. 2), entschloß sich - angeblich auf Grund der Bombenwarnung - quasi erst in letzter Minute dazu, diese Reise mitzumachen (Botting 1993, S. 154 u. 164), welche seine letzte werden würde. Der Rat von K. Rauch, die Post von Angehörigen der Zeppelin-Gesellschaft durchsuchen zu lassen, wurde übrigens nicht befolgt, denn diese Arbeit erledigten nach Douglas Botting nicht näher bekannte „Deutsche Sicherheitsbeamte" (Botting 1993, S. 154). Ziel der Durchsuchung waren „das Luftschiff und das Passagiergepäck" (ebd.); von Post und Fracht ist - zumindest hier - nicht die Rede!
Der Brand mit seinen Folgen ist so oft und detailliert dargestellt worden (ausführlich: Toland 1989 und Archbold 1994), daß hier nicht näher darauf eingegangen werden kann. Vielmehr sollen einige zeitgenössische Pläne und Photographien mit Erläuterungen den Vorgang in Erinnerung rufen:
 Wegen eines Gewitters mußte der LZ 129 - von New York her kommend - nach Erreichen von Lakehurst (bei Philadelphia) zunächst Ausweichkursen folgen.
Wegen eines Gewitters mußte der LZ 129 - von New York her kommend - nach Erreichen von Lakehurst (bei Philadelphia) zunächst Ausweichkursen folgen.
 Der Landeanflug wurde mit einer scharfen Rechtskurve zum Landemast hin abgeschlossen.
Der Landeanflug wurde mit einer scharfen Rechtskurve zum Landemast hin abgeschlossen.
 Noch unmittelbar vor der Ankunft wurde Wasserstoff aus den Gaszellen abgelassen.
Noch unmittelbar vor der Ankunft wurde Wasserstoff aus den Gaszellen abgelassen.
 Im Anflug auf den Luftschiffhafen Lakehurst bot der LZ 129 ein grandioses Bild.
Im Anflug auf den Luftschiffhafen Lakehurst bot der LZ 129 ein grandioses Bild.
 Sekunden vor dem Erscheinen der Stichflamme an der Backbordseite des Hinterschiffes waren bei diesem Foto keine eindeutigen Anzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Brandes ersichtlich; allerdings verschwindet der Bereich am Schiffsrücken unmittelbar vor der oberen Stabilisierungsfläche etwas im Dunst, wobei es sich vielleicht um ein Gemisch mit abgelassenem Wasserstoff handelt.
Sekunden vor dem Erscheinen der Stichflamme an der Backbordseite des Hinterschiffes waren bei diesem Foto keine eindeutigen Anzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Brandes ersichtlich; allerdings verschwindet der Bereich am Schiffsrücken unmittelbar vor der oberen Stabilisierungsfläche etwas im Dunst, wobei es sich vielleicht um ein Gemisch mit abgelassenem Wasserstoff handelt.
 Die Flammen an der Backbordseite und im Innern des Luftschiffes lassen eine enorme Energie erkennen, wobei nach einer Erschütterung deutlich erkennbar zwei Tanks im Vorderschiff herausfallen.
Die Flammen an der Backbordseite und im Innern des Luftschiffes lassen eine enorme Energie erkennen, wobei nach einer Erschütterung deutlich erkennbar zwei Tanks im Vorderschiff herausfallen.
 Ein wenige Sekunden später erkennbarer Rauchpilz entwickelte sich so schnell, daß nur kurzzeitig ein Rauchring backbordseitig hinter einem dunkleren Feuerball (über dem Schiffsrücken) erkennbar war; aus dem Zentrum schossen kleinere Trümmer mit zunächst heller Rauchfahne exzentrisch hervor.
Ein wenige Sekunden später erkennbarer Rauchpilz entwickelte sich so schnell, daß nur kurzzeitig ein Rauchring backbordseitig hinter einem dunkleren Feuerball (über dem Schiffsrücken) erkennbar war; aus dem Zentrum schossen kleinere Trümmer mit zunächst heller Rauchfahne exzentrisch hervor.
 Der Absturz erfolgte wegen des enormen Gasverlustes in der hinteren Schiffshälfte und wegen des explosionsbedingten Schubs schon bei starker Schräglage - mit dem Heck zuerst - etwa eine halbe Minute nach der Entflammung. Die sekundäre Explosion sowie das anschließende Abkippen hatte wesentlichen Einfluß auf die Zahl der Todesfälle, da sich viele der an Bord befindlichen Personen nun nicht mehr festhalten konnten.
Der Absturz erfolgte wegen des enormen Gasverlustes in der hinteren Schiffshälfte und wegen des explosionsbedingten Schubs schon bei starker Schräglage - mit dem Heck zuerst - etwa eine halbe Minute nach der Entflammung. Die sekundäre Explosion sowie das anschließende Abkippen hatte wesentlichen Einfluß auf die Zahl der Todesfälle, da sich viele der an Bord befindlichen Personen nun nicht mehr festhalten konnten.
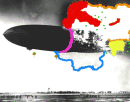 violett: Trennlinie zwischen äußerlich intaktem und zerstörtem Teil; orange: heller, offenbar aus einer schrägen Stichflamme hervorgegangener Brand; gelb: sekundärer heller Brand im Schwanz; rot: dunkelwolkiger Feuerball; grün: Trümmerteile; grünbrau: die beiden fallenden Tanks; blau: dunstig wirkende Zone, eventuell aus gerade entstandenem Wasser.
violett: Trennlinie zwischen äußerlich intaktem und zerstörtem Teil; orange: heller, offenbar aus einer schrägen Stichflamme hervorgegangener Brand; gelb: sekundärer heller Brand im Schwanz; rot: dunkelwolkiger Feuerball; grün: Trümmerteile; grünbrau: die beiden fallenden Tanks; blau: dunstig wirkende Zone, eventuell aus gerade entstandenem Wasser.
 blau: Trennlinie zwischen äußerlich intaktem und zerstörtem Teil; orange: heller Brand; gelb: sekundärer heller Brand im Schwanz; rot: dunkelwolkiger Feuerball; grün: Trümmerteile; grünbrau: die beiden fallenden Tanks; violett: Qualmstreifen wegfliegender Trümmerstücke.
blau: Trennlinie zwischen äußerlich intaktem und zerstörtem Teil; orange: heller Brand; gelb: sekundärer heller Brand im Schwanz; rot: dunkelwolkiger Feuerball; grün: Trümmerteile; grünbrau: die beiden fallenden Tanks; violett: Qualmstreifen wegfliegender Trümmerstücke.
 Von den zahlreich vorhandenen Besatzungsmitgliedern befanden sich zur Zeit des Brandes nur wenige im hinteren Teil des Schiffes, wie aus einer Darstellung im deutschen Untersuchungsbericht hervorgeht.
Von den zahlreich vorhandenen Besatzungsmitgliedern befanden sich zur Zeit des Brandes nur wenige im hinteren Teil des Schiffes, wie aus einer Darstellung im deutschen Untersuchungsbericht hervorgeht.
Es mutet schon ein wenig befremdlich an, doch das Ereignis war nicht nur eine Katastrophe an sich wie einst der einsame Untergang der ähnlich großen (und gleichfalls für absolut sicher gehaltenen) „Titanic" - es war zweifellos auch ein Medienereignis; John Toland erfaßte die Situation wie folgt: „Noch niemals hatte eine Katastrophe eine so starke Wirkung gehabt wie die Explosion der Hindenburg. Niemals zuvor waren Fotografen und Wochenschauleute schon zur Stelle gewesen, um über eine Tragödie zu berichten, und innerhalb weniger Stunden wurden schockierende Aufnahmen des Feuers um die ganze Welt telegrafiert." (Toland 1989, S. 262 f; vgl. Knäusel 1988, S. 28). J. Toland hob gewiß auch mit Recht die aus der Katastrophe hervorgegangene Kombination aus Unglauben und tiefem Schock hervor, denn „die Welt war von der absoluten Sicherheit der Passagier-Zeppeline überzeugt gewesen" (Toland 1989, S. 263).
Mehr als die Frage nach dem Verlauf des Ereignisses hat die Welt diejenige nach den Ursachen bewegt. Wollte man von einem Attentat ausgehen, so fehlte neben den Tätern auch ein überzeugendes Motiv. Gegen den Nationalsozialismus kann ein Attentat ebenso wenig gerichtet gewesen sein wie gegen die deutsch-amerikanische Freundschaft. Beides bedurfte des Zeppelins nicht, und dieser war auch kein Symbol einer der beiden Haltungen. Auch der seinerzeit bestehende Bürgerkrieg in Spanien dürfte eher für Gesprächs- als für Zündstoff gesorgt haben. Den Brandschaden zu tragen hatten vor allem das Transportunternehmen und die Versicherung, kein Volk oder Regime, zumal kein wichtiger Regierungsvertreter an Bord war. Für das Regime konnte die Gelegenheit zu einem gewaltsamen Akt zur Beförderung der Staatsziele hingegen kaum günstiger sein. Denn aufgeschreckt durch die vielleicht gezielt gesteuerte, jedenfalls an den deutschen Botschafter in den USA gerichtete Bombenwarnung schaltete man auf Seiten der Zeppelin-Reederei tatsächlich den Staatsschutz ein, und so konnten sogenannte „Sicherheitsbeamte" vor dem Abflug des LZ 129 ungestört in seinem Innern werkeln, wobei sie sich auch am Passagiergepäck zu schaffen machten (Botting 1993, S. 154). Inwieweit sie dabei etwa von Vertretern der Reederei oder des Herstellers kontrolliert wurden, steht dahin. Angesichts des gespannten Verhältnisses zwischen Hugo Eckener und dem Regime dürfte die „Zusammenarbeit" kaum günstig vonstatten gegangen sein. Ein ungutes Gefühl mag Ernst A. Lehmann daher wohl auch kurzfristig dazu bewogen haben, entgegen seiner früheren Absicht an der Schicksalsfahrt teilzunehmen (vgl. Botting 1993, S. 154). Er sollte deren abruptes Ende nur kurze Zeit überleben!
3.1. Ansichten zum Hergang bei den Zuschauern
Neben Insassen des Luftschiffs können vor allem die Mannschaften und Zuschauer am Boden als Zeugen des Geschehens gelten, welche über den Beginn und Verlauf des Unglücks Aussagen zu treffen vermögen. Hierbei sollte man sich bewußt machen, daß die Bildung einer Meinung den unmittelbaren Eindruck oft schnell verwischen kann. So wurde Rich Archbold zufolge der Brand des Schiffes von den meisten Leuten am Boden erst wahrgenommen, als eine pilzförmige Flamme vor dem vorderen Ende der oberen Heckflosse (der oberen Seitenstabilisierungsfläche des Leitwerks) nach oben schoß (Archbold 1994, S. 183). Dabei gibt es jedoch zu der Stelle, wo die erste Flamme erschien, sehr widersprüchliche Angaben, worauf schon der deutsche Untersuchungsbericht hinwies.
Als zeitnah sowohl in Schilderung als auch Veröffentlichung kann diesbezüglich der Bericht eines Augenzeugen gelten, welcher zwar nicht namentlich erwähnt, doch als der „am Schauplatz der Unglücksstelle weilende Berichterstatter des DNB." bezeichnet wurde (N. N. 1937, Sp. 1): „Um 19.23 Uhr aber schoß plötzlich aus mittlerer Höhe des Hinterschiffes eine Stichflamme heraus [sic!]. Dann folgte ein dumpfer Knall. In Bruchteilen einer Sekunde war das Hinterschiff in ein einziges Flammenmeer verwandelt[,] und die Feuergarben erfaßten sofort auch das ganze Schiff, das langsam zu Boden sank und ausbrannte. Ich selbst befand mich etwa 150 Meter vom Ankermast entfernt." (ebd.). Demnach wurde hier eine erste Flamme nicht auf dem Schiffsrücken, sondern etwa auf halber Höhe der Backbord-Seite des Hinterschiffes beobachtet. Ein anderer Augenzeuge will zunächst „einen schwachen rötlichen Feuerschein" im unteren Teil des mittleren Schiffsabschnittes wahrgenommen haben (Botting 1993, S. 159). Ein weiterer Beobachter sah das Heck wie „eine Art Lampion" aufleuchten und lodernde Flammen das Schiffsinnere erhellen, wobei sich der Schatten des Gerippes dunkel auf der sonst erhellten Hülle abgehoben haben soll (ebd.). Aus diesen drei voneinander abweichenden Schilderungen läßt sich wenigstens ersehen, daß ein erster Brandherd mehr im Innern des Schiffes, nicht unmittelbar an seiner Außenhaut, wahrgenommen wurde, und zwar eher im Hinterschiff.
Der amerikanische Fregattenkapitän Charles Emery Rosendahl (*1892 - †1977), selbst ein erfahrener Gerüstluftschiff-Kapitän und mittlerweile „Kommandant der Marinestation Lakehurst" (N. N. 1937 c, Sp. 2), beobachtete gemäß einer bereits am 8. Mai 1937 publizierten Sammlung von Augenzeugenberichten (N. N. 1937) - welche sich auf die Beschreibung „in seinem Bericht an das Marineamt über die Katastrophe" bezog (ebd., Sp. 1) - zunächst ein nicht näher umschriebenes Feuer im hinteren Abschnitt des Zeppelins: „Etwa vier Minuten nach dem Herabwerfen der Seile sei Feuer am Hinterschiff erschienen, das sich nach dem Vorderschiff hin ausbreitete." (ebd., Sp. 1 f). Vor dem mittlerweile eingesetzten „Untersuchungsausschuß des Wirtschaftsministeriums" soll C. E. Rosendahl dann drei Tage später gemäß eines weiteren Berichtes der selben Zeitung - jetzt vom 11. Mai - ausgeführt haben, „daß er, der dem [Lande-]Manöver aufmerksam von Anbeginn an zusah, unter dem Schiffsleib, also außenbords, eine kleine Flammengarbe gesehen und tief erschrocken sogleich das Gefühl gehabt" habe, „daß das den Untergang des Schiffes bedeute" (N. N. 1937 c, Sp. 2): „Tatsächlich sei dann nach dieser ersten kleinen Stichflamme [sic!] das ganze Schiffsheck in Flammen aufgegangen. Rosendahl bekundet dann weiter, daß er sehr überrascht gewesen sei, daß es nicht zu einer großen und schweren Explosion kam. Die in Verbindung mit dem Brand zu hörenden Detonationen könnten nach seiner Meinung nur auf die Flammen zurückzuführen sein." (ebd.). Rosendahl leugnete demnach nicht, daß es zu einer ersten kleinen Explosion mit dumpfen Knall und Erschütterung des ganzen Schiffes kam, allerdings schloß er aus, daß der Zeppelin in größerem Ausmaß explodierte. Die Schilderung gleicht den vorigen Schilderungen, wonach der erste Brand im Bereich des Hinterschiffes stattgefunden habe. Möglicherweise beruht die Angabe, daß die erste Flammengarbe unter dem Schiffsleib ersichtlich gewesen sei, auf einem Übersetzungsfehler, denn nach anderer Quelle (Botting 1993, S.159) soll C. Rosendahl von einem kleinen Brand „dicht vor der oberen Seitenflosse", also vor dem vorderen Ansatz der oberen Seitenstabilisierungsfläche berichtet haben, eine Lokalisierung, welcher letztlich auch - nach Hinweisen auf die Uneinheitlichkeit der Zeugenberichte - der deutsche Untersuchungsbericht folgte. Ist das Feuer stichflammenartig an der Außenhaut des Schiffes entstanden - etwa an der Backbordseite, während neuere Untersuchungen (etwa seitens der NASA) einen Ursprung am hinteren Schiffsrücken unterstellen (vgl. Archbold 1994, S. 190, obere Abb.) -, so fragt man sich allerdings, warum andere Wahrnehmungen - vor allem seitens der Besatzung - sich auf das Luftschiff-Innere im Bereich der Gaszellen 4 und 5 (zwischen den Hauptringen mit den Nummern 47 und 77) beziehen; hier könnte der mangelnde Überblick der betreffenden Personen eine Rolle spielen. C. Rosendahl blieb jedenfalls Anhänger der Sabotagetheorie (Botting 1993, S. 164).
Im Untersuchungsbericht wurde eine sonst nicht mitgeteilte Beobachtung eines Zeugen namens R. H. Ward für erwähnenswert gehalten, wonach er unmittelbar vor dem Feuerausbruch „ein Flattern der Außenhaut an der oberen B.B.[Backbord]-Seite zwischen den Ringen 62 und 77, die die Zelle Nr. 5 einschlossen, beobachtet" habe (Eckener et al. 1937, S. 145; Knäusel 1988, S. 84). Zu diesem Zeitpunkt habe das Luftschiff bereits „keine Fahrt" mehr gehabt, so daß nach Ansicht der Berichterstatter „diese Wellenbewegung der Außenhaut möglicherweise durch Gas verursacht worden" sei, welches „aus einer Zelle ausströmte" (Eckener et al. 1937, S. 145; Knäusel 1988, S. 84/86).
Als weiterer Augenzeuge wurde am 10. Mai Wilhelm von Meister, Vizepräsident der erst im Winter 1936/37 gegründeten „American Zeppelin Transport Corporation" und Amerika-Repräsentant der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, vernommen (N. N. 1937 c, Sp. 3 f): „Von Meister bemerkte sehr starkes Licht in der oberen Finne [= oberen Stabilisierungsfläche (D.R.)], dann sei eine Flamme aus der Backbordseite [des Schiffes] herausgeschlagen. Im Nu stand das ganze Heck in Flammen[,] und das Luftschiff sank zu Boden." (ebd., Sp. 4). Hier wurde an Stelle einer ersten Flamme wieder von einem Licht - diesmal allerdings nicht im eigentlichen Schiffskörper, sondern nur in der oberen Stabilisierungsfläche - gesprochen und der erste Brand in Form einer Stichflamme wieder an der linken Seite des Schiffskörpers - also keineswegs am Schiffsrücken - lokalisiert. Erneut wird von einer aus dem Innern des Zeppelins herausschlagenden Flamme berichtet, und erst danach sei der Zeppelin abgestürzt. Welcher Art das Heckflossenlicht gewesen sein könnte, blieb zunächst ebenso dahingestellt wie die Weise, auf welche es eventuell die Entzündung des Brandes bewirkt haben könnte. W. v. Meister stand mit seiner Beobachtung immerhin nicht alleine da, denn auch Monty Rowe - einer der Überlebenden der ZR-5-„Macon"-Katastrophe vom Frühjahr 1934 - sah „die Flossen merkwürdig hell werden" (Toland 1989, S. 240). Die Lichterscheinung wurde später gewöhnlich unter Hinweis auf die gewitterige Luft als Elmsfeuer interpretiert.
3.2. Auffassungen beim Personal
Als die wichtigsten Leute an Bord nach ihrer Meinung zur Ursache des „Hindenburg"-Brandes befragt wurden, so gaben diese - vielleicht unter dem Eindruck der Warnung von K. Rauch - zeitnah eine Bombe an. So soll Ernst A. Lehmann auf dem Totenbett seinem Freund Fregattenkapitän C. Rosendahl erklärt haben, daß es „eine Höllenmaschine gewesen sein" müsse (Toland 1989, S. 265; Botting 1993, S. 164). Gleicher Auffassung war der amtierende Zeppelin-Kapitän Max Pruß (Botting 1993, S. 164), welcher einmal zu seinen nächsten Verwandten gesagt haben soll, „daß sein Luftschiff sicherer sei als jeder Ozeandampfer" (N. N. 1937 b, Sp. 5). M. Pruß erwarb „seine ersten Luftschiffer-Kenntnisse" auf Kielluftschiffen der Marke Parseval (N. N. 1937 b, Sp. 5), welche vor dem und zu Beginn des Ersten Weltkrieges eingesetzt wurden (vgl. Meyer 1980, S. 112 f).
Unter den überlebenden Besatzungsmitgliedern waren freilich nur wenige, welche sich nahe genug am Geschehen befanden, um über detailierte Beobachtungen berichten zu können. Zwei der vier Leute, welche sich in der unteren Heckflosse aufhielten, wollen zunächst in der Mitte der Gaszelle 4 (etwa fünfzehn Meter schräg vor und über ihnen) einen grellen rot-blau-gelben Feuerschein von Kugelform mit etwa einem Meter Durchmesser aufflackern bzw. aufblitzen gesehen und unmittelbar darauf ein dumpf klingendes Fauchen gehört haben; dann sei die ganze Zelle mit allerdings gedämpften Knall explodiert (Botting 1993, S. 159). John Toland (Toland 1989, S. 242) nannte als Hauptzeuge den - sonst nicht unter diesem Namen genannten (vgl. den die Besatzung betreffenden Lageplan im deutschen Untersuchungsbericht: Eckener et al. 1997, S. 150 f - hier ausschnittsweise wiedergegeben als Graphik „Besatzung.png")! - "Mechaniker Georg Haupt", welcher am Heck des Schiffes „den Hauptkiel entlang" (den kielnahen Laufgang entlang?) gegangen und zunächst Feuer in Gaszelle 4 gesehen haben soll, welches dann mit lautem Knallen („wie bei einem Gasherd, bei dem vor dem Anzünden schon Gas ausgeströmt ist") auf die Gaszellen 3 und 5 übergesprungen sei. Wer immer hier auch gemeint war - Helmut Lau befand sich im Laufgang am Fuße der unteren Leitwerkfläche nahe Rudolf Sauter, welcher sich im dortigen Hilfssteuerraum aufhielt; diese beiden Besatzungsmitglieder konnten von ihrem Standort aus nur die rückwärtige Wand der Gaszelle 4 sehen (Archbold 1994, S. 181). H. Lau hörte - entsprechend der Angabe bei J. Toland - zunächst einen Laut wie beim Anzünden eines Gasbrenners und sah einen Feuerschein bei Gaszelle 4, welchen er aber wegen der Sichtbeschränkung nicht sicher lokalisieren konnte (er nahm nur einen hellen Widerschein im unteren Steuerbordbereich der Zellenhaut wahr), während R. Sauter den Ursprung der Flammen im Zentrum der Gaszelle 4 zu erkennen glaubte, wo der Mittelgang des Zeppelins entlangführte (Archbold 1994, S. 181). Der eigenartige Knall wurde übrigens von anderen Zeugen als „eine kleine, dumpfe Detonation - ähnlich dem Öffnen einer Bierflasche" (wohl mit Bügelverschluß) - beschrieben (Toland 1989, S. 242). John Toland zufolge klang die „Explosion, die durch das erste Aufflammen des Feuers ausgelöst wurde", desto „lauter, je größer die Entfernung war" (Toland 1989, S. 241). Dem Brandherd am nächsten stand übrigens Hans Freund, und zwar im Laufgang am Kiel unmittelbar vor der Öffnung zur unteren Heckflosse, wo er eine Trosse zum Verankern hinabließ (Archbold 1994, S. 181, Sp. 1); auf diese Weise den Gaszellen seinen Rücken zukehrend, konnte er keinen Brandherd lokalisieren (Archbold 1994, S. 181, Sp. 2).
Welche Kräfte bei der eigentlichen, explosionsartigen Erschütterung wirkten, geht schließlich aus dem zeitnahen Bericht „in gebrochenem Englisch" (N. N. 1937, Sp. 1) des Mechanikers Theodor Ritter hervor, welcher den Brand von der vorderen Backbordmotorgondel aus erlebte: „Wir stoppten gerade die Motoren, als plötzlich ein Blitz aufflammte und eine riesige Stichflamme in den Himmel loderte." (N. N. 1937, Sp. 1; vgl. die Darstellung bei Toland 1989, S. 246!). Danach gewann er den Eindruck, daß die Gondel vom Schiff abbreche: „Unsere Gondel wurde aus dem Rumpf herausgelöst und zur Erde geschleudert." (ebd.). Nach dieser Schilderung käme ein Blitz als Brandursache in Frage (Kugelblitz?), doch geht aus dem Text nicht eindeutig hervor, ob die am vorderen Backbordmotor beschäftigten Maschinisten einen solchen tatsächlich sahen oder bloß wegen des Aufblitzens annahmen. Ein Blitz wäre zudem vermutlich eher am Schiffrücken eingeschlagen, wo er von den Mechanikern kaum hätte gesehen werden können. Die Unzuverlässigkeit der Schilderung zeigt sich auch darin, daß die Gondel sich während des Zeppelin-Absturzes nicht löste, wie aus den publizierten Fotos hervorgeht (vgl. die Situation unmittelbar nach dem Aufprall der Gondel bei Botting 1993, S. 170 f, hier gleich links von der Person im Vordergrund).
Was die an Bord befindlichen Luftschiff-Offiziere angeht, vor allem die Kapitäne Ernst A. Lehmann und Max Pruß (wie bereits erwähnt), so vertraten sie - soviel bekannt ist - den Standpunkt, daß als Ursache für die Katastrophe ausschließlich eine Bombe infrage käme (Botting 1993, S. 164); allerdings schloß E. Lehmann anscheinend zunächst gleichfalls einen Blitz nicht aus (siehe Toland 1989, S. 259 f).
3.3. Der schwierige Standpunkt von Hugo Eckener
Aus heutiger Sicht erscheint es geradezu als grotesk, daß Hugo Eckener nach ersten Äußerungen über mögliche Ursachen des Brandes nach Berlin ins „Luftfahrt"-Ministerium zu Hermann Göring zitiert wurde, welcher ihm umgehend verbot, öffentlich auch nur in Erwägung zu ziehen, daß man mit einer Bombe bzw. mit Sabotage rechnen müsse (Archbold 1994, S. 196, Sp. 2). Entsprechend pathetisch klang dann auch die darauf folgende, von Propagandaminister Dr. J. Goebbels abgesegnete Presse-Erklärung des Aufsichtsratsvorsitzenden vom 7. Mai: „Aus der Besprechung mit Generaloberst Göring habe ich die felsenfeste Gewißheit mitgenommen, daß Deutschland unerschütterlich an der Idee des Luftschiffbaues und des Luftschiffverkehrs festhält." (Eckener 1937, Sp. 3). Es hat freilich den Anschein, als ob diese Zusage weiterer Unterstützung sozusagen das Entgelt für das dem H. Eckener auferlegte öffentliche Verhalten darstellt. Das Einlenken gegenüber dem Minister erfolgte freilich nicht gänzlich uneingeschränkt: „An teilweise recht auseinandergehenden Meldungen sind Vermutungen geknüpft worden, deren Richtigkeit sich aus der Entfernung keinesfalls beurteilen läßt. [...] Selbstverständlich wird auch die Frage einer etwaigen Sabotage, an die ich im ersten Augenblick, wie ich gestehe [sic! (D.R.)], selbst noch gedacht habe, ernstlich zu untersuchen sein. Auf Grund neu eingetroffener Meldungen aus Amerika und angesichts der ausgezeichneten organisatorischen Maßnahmen der amerikanischen Regierung liegt aber für diese Ansicht nur noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit vor." (Eckener 1937, Sp. 2). Unmittelbar an dieses wohl nicht ganz dem Wunsch des „Reichsluftfahrtminister Generaloberst Göring" (ebd.) folgenden Dementi schloß sich die Darstellung der neuen Sichtweise an: „Näher liegt dagegen die Vermutung, daß elektrische Vorgänge, die vielleicht auf die Witterungslage zurückzuführen sind, eine Rolle bei diesem Unfall [sic! (D.R.)] gespielt haben." (ebd.).
Im Anschluß an das Statement machte sich Eckener in Begleitung der „Herren Dr. Dürr vom Luftschiffbau Zeppelin, Professor Dr. Breithaupt, Oberstleutnant im Reichsluftfahrtministerium, Professor Bock und Stabsingenieur Hof[f]mann von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt und Professor Die[c]kmann von der Technischen Hochschule in München" auf den Weg in die USA (ebd.). Wie immer Eckener später hinsichtlich der Brandursache urteilen würde, in seinen Äußerungen hat er - entsprechend der Forderung des Nazi-Regimes - nie wieder den Standpunkt eines möglichen Attentates vertreten. Es bleibt unklar, ob dies als Zeichen einer - auch anders belegbaren - späten Loyalität zu werten ist oder ob er von der Vorstellung, daß „elektrische Vorgänge" der eigentliche Auslöser waren, überzeugt wurde.
3.4. Die Ergebnisse der Untersuchungskommissionen
Im deutschen Untersuchungsbericht (Eckener et al. 1997, S. 154) wurde eine Brandentstehung auf Grund von elektrischen Spannungsunterschieden zwischen Gerippe und Außenseite der Luftschiffhülle für wahrscheinlicher gehalten als eine Zündung durch „Büschelentladungen" (Elmsfeuer). Demnach könne die Bildung eines zündfähigen Funkens durch die Außenhaut hindurch erfolgen, wenn sich das luftelektrische Potentialgefälle hinreichend stark und rasch ändere (Eckener et al. 1997, S. 152, Sp. 2). Eine nicht auszuschließende Entzündung von Wasserstoff durch ein Elmsfeuer wäre „am oberen Teil der senkrechten Stabilisierungsfläche" zu erwarten, das heißt „über der Vertikalflosse des Schiffes", und da Knallgas weitgehend farblos brenne, sei mit einer unsichtbaren Ausdehnung des Feuers zu rechnen (Eckener et al., S. 152, Sp. 1). In diesem Zusammenhang wird gerne auf zwei angeblich glaubwürdige Zeugen verwiesen, welche übereinstimmend ausgesagt haben sollen, „sie hätten eine Minute vor dem Ausbruch des Brandes die bläulichen Flammen des Elmsfeuers über den Luftschiffrücken huschen [ge]sehen" (Botting 1993, S. 164).
Auch der Frage eines Kugelblitzes - als mögliche Brandursache - wurde im deutschen Untersuchungsbericht nachgegangen, doch mit der Begründung verworfen, daß solche Erscheinungen „meist in Verbindung mit Linienblitzen auftreten", während „das sichtbare Gewitter über Lakehurst bereits vor längerer Zeit hinweggezogen" sei (Eckener et al. 1937, S. 153, Sp. 2; Knäusel 1988, S. 98).
Der weitere Verlauf des Brandes setzt eine starke Wasserstoff-Luft-Vermischung in der Nähe des Brandherdes voraus. Seinerzeit wurde allerdings keine Druckabweichung in den Gaszellen an Hand der verfügbaren Feindruckmesser erkannt, welche auf eine Wasserstoff-Ausbreitung hätte schließen lassen. Laut deutschem Untersuchungsbericht (Eckener et al. 1997, S. 148, Sp. 2) wäre bei 80 % praller Gaszelle bei genügender Aufmerksamkeit des Personals das Entweichen von 100 Kubikmeter Wasserstoff (von insgesamt 190.000 in den sechszehn Gaszellen) erkennbar gewesen, wobei Störungen in der Technik sehr unwahrscheinlich seien, solche in der Aufmerksamkeit des Personals (wohl wegen der Todesfälle) jedoch ungeklärt bleiben müssten. Mitglieder der deutschen Untersuchungskommission gelangten letztlich zu der Überzeugung, daß sich zwischen den Gaszellen 4 und 5 ein Luft-Wasserstoff-Gemisch gebildet habe, welches durch eine elektrische Entladung entzündet worden sei (Botting 1993, S. 164; vgl. Eckener et al. 1997). Falls ein explosives Luft-Wasserstoff-Gemisch am unmittelbar folgenden Verlauf des Brandes beteiligt war, so wäre seine Herkunft freilich mangels rechtzeitiger Wahrnehmung unklar.
Von Kritikern der Elektrotheorie wurde unter anderem die Dauer von immerhin vier Minuten zwischen dem Beginn der Erdung des Zeppelins als Ganzes (durch die herabgeworfenen, schnell feucht werdenden Taue) und der ersten Stichflamme bemängelt. Ob ein elektrischer, bis ins Innere einer intakten Gaszelle vordringender Funke deren Inhalt trotz des Mangels an Luft zur Entzündung bringen könnte, wurde nicht weiter diskutiert; dabei lagen ja ausreichende Hinweise auf eine Beschädigung oder auf eine andere Undichtigkeit bei den Zellen nicht vor. Ebenso wenig wurde anscheinend ein möglicher Einfluß des im Gas enthaltenen Duftstoffes untersucht.
Wichtig ist, daß auch der deutsche Untersuchungsbericht letztlich ein Attentat als Absturzursache des LZ 129 nicht ausschloß: „Die Möglichkeit einer gewaltsamen Zerstörung des Luftschiffes muß aber, da eine andere Entstehungsursache ebensowenig bewiesen werden kann, zugegeben werden." (Eckener et al. 1997, S. 147, Sp. 2) - Damit stand auch diese Stellungnahme nicht im Einklang mit der politischen Forderung, welche Hermann Göring unmittelbar nach der Katastrophe vertreten hatte; sie war schon allein wegen der amerikanischen Untersuchungen nicht aufrecht zu erhalten.
Trotz aller offenen Fragen schloß sich der amerikanische Untersuchungsbericht den Auffassungen der deutschen Kommission an, wonach der Brand wahrscheinlich durch elektrische Entladung und Knallgasbildung entstanden sei (Botting 1993, S. 164; Archbold 1994, S. 202 f).
3.5. Neuere Ansichten
Auch Jahrzehnte nach dem Brand werden noch Argumente zur Entstehung des Feuers ins Feld geführt, welche wichtige Aspekte in den Vordergrund rücken. So hob Hans G. Knäusel das leichtsinnige Ablassen von Wasserstoff beim Landemanöver hervor. Im deutschen Untersuchungsbericht heißt es dazu: „Da das Schiff hecklastig war, wurde weiterhin vor und während der letzten Kurve an den vorderen 5 Zellen zweimal 15 Sekunden lang und einmal 5 Sekunden lang Gas gezogen." (Eckener et al. 1937, S. 144, Sp. 1; Knäusel 1988, S. 83 f). H. Knäusel wies in diesem Zusammenhang auf ein auf die Probe- und Werkstattfahrten des LZ 130 bezugnehmendes Schreiben der DZR hin, wonach nunmehr „das Gasziehen unmittelbar vor der Landung, wenn die Fahrt bereits erheblich verlangsamt oder gar vollständig aus dem Schiff" sei, „auf jeden Fall" vermieden werden müsse, weil „bei geringer Fahrt die Ventilation im Schiff erheblich nachläßt" (zitiert nach Knäusel 1988, S. 17). Knäusel folgerte: „Wichtig, ja lebenswichtig war, abgeblasenes Wasserstoffgas sofort vom Schiff wegzubekommen, was nur in Fahrt möglich ist. Wird beim Abblasen sogar [die Fahrtrichtung] reversiert, kann es im Innern des Schiffes zur Knallgasbildung kommen, weil das Gas nicht abziehen kann." (Knäusel 1988, S. 16 f). Damit dürfte eine zweite - neben der auf natürliche Weise erfolgten Zündung im Bereich der hinteren Abgaskappen - unmittelbar mögliche Brandursache erfaßt sein. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Kapitän Max Pruß beim Landemanöver anders agierte als es etwa Hugo Eckener zu tun pflegte (vgl. Toland 1989, S. 237).
In jüngerer Zeit (vgl. N.N. 1997) wird wieder vorwiegend auf die Spannungsunterschiede an der Luftschiffhaut verwiesen, wobei neuere Untersuchungen eine besondere Feuergefährlichkeit des Hüllenaußenauftrags ergeben hätten (vgl. zur Hülle mit „Cellon"-Anstrich beim LZ 126 Wittemann 1925, S. 42 u. 46; beim LZ 129 wurde offenbar anderes Material verwendet); diese habe eine Entzündung begünstigt. Ein kleiner Funke reicht gemäß der Untersuchungsergebnisse seitens der NASA aus, um den noch neuen Anstrich der Außenhaut zu entzünden; dies sei an der Farbe der Flammen erkennbar; denn während eine Wasserstoff-Verbrennung nahezu farblos erfolgt wäre, sei der Hüllenbrand deutlich wahrzunehmen gewesen (N.N. 1997, Sp. 3). Die rasche Ausbreitung des Feuers wird gerade mit der Art der Hüllenbeschichtung begründet; die Vergrößerung des Brandherdes - egal durch welche Art Spannungsunterschied das Feuer bewirkt wurde - habe vorwiegend an der Hülle und weniger im Innern des Schiffes stattgefunden. Die Entzündung des Wasserstoffes sei nachrangig erfolgt, nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Entstehung des ersten Feuers. Eine Explosion an Bord - kenntlich neben dem Knall auch an einem nach vorne gehenden Ruck (Stoß) im Schiff unmittelbar zuvor (Toland 1989, S. 242), sowie am Abfallen zweier Tanks - wird bei Bain et Schmidtchen 2000 überhaupt bestritten; diese Ablehnung geschah offensichtlich zur Unterstützung des Postulates, nach dem der Brand wegen der Feuergefährlichkeit der Außenhülle bei Verwendung von Helium als Traggas einen vergleichbaren katastrophalen Verlauf genommen hätte. Letzteres ist eine These, welche auf Grund von Erfahrungen mit Helium-Prallluftschiffen beruhen dürfte (vgl. das Foto eines am Ankermast verbrennenden Blimps bei Bock et Knauer 2003, S. 171, Abb. 4.2.32; zu den verfügbaren Traggasen siehe ebenda, S. 57 f).
3.6. Eigener Standpunkt
So brilliant die neueren naturwissenschaftlichen Untersuchungen zur möglichen elektrischen Entzündung und weiteren Verbrennung der Außenhülle auch erscheinen (siehe dazu Bain et Schmidtchen 2000), so ergeben sie bloß theoretische Ursachen technologischer Art und nehmen wenig Rücksicht auf den in den Photographien und an Hand von deren Abfolge erkennbaren Verlauf des Brandes, welcher schließlich zu einer weiteren Stichflamme am Bug des Schiffes und zum Tod von - unter anderem - letztlich dreizehn Passagieren führte. Selbst wenn die leichte Entzündbarkeit des Hüllenanstrichs einen Einfluß auf die Brandentfaltung nahm - woran auch wohl kein Zweifel bestehen dürfte -, bliebe noch zu untersuchen, ob die Existenz der Feuergefährlichkeit des Hüllenanstrichs bloß auf Nachlässigkeit oder gar auf der heimtückischen Absicht Eingeweihter beruhte. Letzteres erscheint derzeit aber als ebenso wenig wahrscheinlich wie die jüngst gerne verbreitete Annahme, wonach der Brand sich hauptsächlich entlang der Luftschiffhülle ausgebreitet habe.
Insgesamt gibt es sechs Anhaltspunkte für technologische Fehler, welche zur Entstehung oder Entwicklung des Brandes beigetragen haben können:
1. Problem: die elektrischen Mängel am Übergang vom Gerüst zur Luftschiffhülle erleichterten Funkenbildung (mit „durchschlagendem" Erfolg) - Lösung: Kontrolle der Elektrizität bei Landemanövern (beim LZ 130 eingeführt)
2. Problem: das überdimensionierte Leitwerk (vgl. Bock et Knauer 2003, S. 216 f) begünstigte elektrische Büschelentladungen (Elmsfeuer) an der oberen Stabilisierungsfläche nahe bei Gasventilationskappen - Lösung: Veränderung der Leitwerkskonstruktion (beim LZ 130 nicht realisiert, obwohl die Flächen keinen Propagandazwecken mehr dienten)
3. Problem: die chemische Zusammensetzung des Außenhüllenanstrichs hatte eine hohe Feuergefährlichkeit der Hülle zur Folge (Zündholzcharakter) - Lösung: Ersetzung des Aluminiums durch Bronze (beim LZ 130 vorgenommen)
4. Problem: das Ablassen von Wasserstoff beim Rangieren erhöhte die Gefahr von Knallgas-Bildung - Lösung: Verzicht auf das Gas-Ablassen bei langsamer oder ruhender Fahrt (beim LZ 130 bereits berücksichtigt)
5. Problem: das Versetzen des Wasserstoffes mit Geruchsmitteln ermöglichte nur Nahestehenden das Erkennen von austretendem Wasserstoff - Lösung: deutliche Färbung des Traggases nach Überprüfung möglicher chemischer Effekte (unbekannt, ob jemals realisiert)
6. Problem: innerhalb der Hülle befindet sich viel Luft außerhalb der Gaszellen, welche bei Anreicherung derselben mit Wasserstoff zu Knallgasbildung führen kann - Lösung: Verzicht auf Lufträume durch umfassendere Gaszellen oder durch Gaszellen-Hüllen-Kombination, etwa in Form einer Metallhülle (beim Projekt WL 1 vorgesehen, siehe Jäger 1956, S. 71).
Bislang nicht beobachtet wurde offenbar ein kleines Objekt links (an Backbord) vor den beiden Gasventilationskappen des Schiffes, welche sich vor der oberen Leitwerksfläche auf dem hinteren Schiffsrücken befinden; diese leichte Erhöhung, etwa von der Größe dieser Kappen, deutet sich auf einem Foto des über Manhattan (New York, USA) fahrenden LZ 129 an:
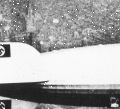 Ansicht etwa um 15 Uhr, also etwa vier Stunden vor der Zerstörung (Archbold 1994, S. 177, obere Abb.). Wegen der Unschärfe der Bildvorlage ist nicht ausgeschlossen, daß die helle Stelle bloß einen Teil des Hintergrundes darstellt, also etwa den Rand eines Hochhausdaches.
Ansicht etwa um 15 Uhr, also etwa vier Stunden vor der Zerstörung (Archbold 1994, S. 177, obere Abb.). Wegen der Unschärfe der Bildvorlage ist nicht ausgeschlossen, daß die helle Stelle bloß einen Teil des Hintergrundes darstellt, also etwa den Rand eines Hochhausdaches.Darüber hinaus erscheint diese konvexe Ausbuchtung anscheinend auf Bildern von dem Landemanöver.
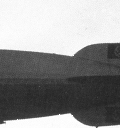 Hier, bei der Annäherung in Lakehurst, tritt die Stelle dunkel hervor, wobei es sich allerdings - angesichts der ungünstigen Perspektive - um die am Schiffsrücken hinterste Backbordventilationskappe selbst handeln könnte (Archbold 1994, S. 180, Abb. oben rechts).
Hier, bei der Annäherung in Lakehurst, tritt die Stelle dunkel hervor, wobei es sich allerdings - angesichts der ungünstigen Perspektive - um die am Schiffsrücken hinterste Backbordventilationskappe selbst handeln könnte (Archbold 1994, S. 180, Abb. oben rechts). Etwas spätere Aufnahme der selben Stelle (Archbold 1994, S. 181, Abb. oben links).
Etwas spätere Aufnahme der selben Stelle (Archbold 1994, S. 181, Abb. oben links). Unmittelbar vor dem Ausbruch des Brandes ist keine Besonderheit erkennbar. Ein im Backbord-Bereich des oberen Hinterschiffes klareres Bild war trotz digitaler Helligkeits- und Kontrastveränderungen bei der verfügbaren Vorlage (Archbold 1994, S. 181, Abb. oben rechts) nicht zu erreichen.
Unmittelbar vor dem Ausbruch des Brandes ist keine Besonderheit erkennbar. Ein im Backbord-Bereich des oberen Hinterschiffes klareres Bild war trotz digitaler Helligkeits- und Kontrastveränderungen bei der verfügbaren Vorlage (Archbold 1994, S. 181, Abb. oben rechts) nicht zu erreichen.Eine backbordseitige beulenartige Erhebung am Schiffsrücken fehlt jedenfalls auf dem Manhattan-Bild des Jahres 1936 (Archbold 1994, S. 166, Abb. o. Nr.); eine Überprüfung ist wegen der Winzigkeit der verfügbar gewesenen Ansichten in jedem Fall an Hand besseren Bildmaterials erforderlich, um nicht unnötig neuen Spekulationen Vorschub zu leisten! Hingewiesen sei aber, daß seinerzeit laut deutschem Untersuchungsbericht (Eckener et al. 1997, S. 145, Sp. 2) immerhin von dem Zuschauer R. H. Ward unmittelbar vor dem Brandausbruch „ein Flattern der Außenhaut an der oberen B.B.[= Backbord]-Seite zwischen den Ringen 62 und 77, die die Zelle 5 einschlossen, beobachtet" wurde (vgl. Archbold 1994, S. 201, Sp. 2). Bekannt ist auch, daß sich das Schiff wegen starker Schwanzlastigkeit nur schwer ins Waagerechte bringen ließ, was für die Landung unbedingt nötig ist (zur Landung von Luftschiffen siehe jetzt Bock et Knauer 2003, S. 323 - 325); dazu wurden nach mehreren unzureichenden Wasserballast-Abwürfen zwecks Gewichtsausgleich sechs Mann der Besatzung „aus der Mitte des Schiffes in den Bug gesandt" (Eckener et al. 1997, S. 145, Sp. 1).
Zu beachten sind auch wiederholte Warnungen vor einem Attentat mittels einer Zeitbombe, welche den LZ 129 betrafen. Bekannt ist diesbezüglich die auffallend konkrete Äußerung von Kathie Rauch vom 8. April 1937, welche über die üblichen Sabotagedrohungen hinausging (Botting 1993, S. 154) und immerhin eine Steigerung der Vorsichtsmaßnahmen zur Folge hatte; selbst Taschenlampen (Botting 1993, S. 154) und funkenbildendes Spielzeug (Archbold 1994, S. 176, Sp. 1) wurden konfisziert, wobei diese Gegenstände allerdings zum Zeitpunkt des Unglücks bereits an die Reisenden zurückgegeben worden waren. Manches in der Entwicklung des Brandes an Bord von LZ 129 - insbesondere die Bewegung des Zeppelins beim Ausbruch des Feuers - spricht tatsächlich für den Einfluß eines Explosivkörpers; eine genaue Rekonstruktion des Ereignisses an Hand der Augenzeugenberichte und des verfügbaren Medien-Materials ist freilich schwierig. Möglicherweise kommt man durch das Morphing von Fotos zu einem Video (eventuell unter Einsatz von Stereotechniken) noch ein Stück weiter.
Wenigstens ein Teil der Augenzeugenberichte spricht für einen Brand- oder Explosionsherd im Innern des Luftschiffes, und da wird man als - eventuell bloß sekundäre - Brandquelle eine automatisch (etwa mittels Zeitschaltung) betriebene Bombe, also eine „Höllenmaschine", derzeit nicht ausschließen können. Eine solche Vorrichtung müßte freilich so konzipiert und positioniert gewesen sein, daß ihre Wirkungsweise keinen Hinweis auf eine beabsichtigte Entstehung des Feuers ergäbe; sie hätte auch so unauffällig sein müssen, daß etwaige Spuren nach dem Brand nicht mehr in ihrer Funktion erkennbar gewesen wären. Es bleibt also noch zu untersuchen, ob die Art der Brandentwicklung nicht durch Brandbeschleuniger begünstigt wurde - wobei hier nicht der Kraftstoff für die Motoren gemeint ist -; im Klartext: ob hier nicht eine eigentlich für später vorgesehene Explosion vorzeitig erfolgte. Hinsichtlich des Brandverlaufs ist dabei zu berücksichtigen, daß die Ausbreitung des Feuers wenigstens zeitweise vor allem entlang des Mittelganges führte (Kaminwirkung?), bis schließlich der Bug des Schiffes erreicht war, während die Hülle des Vorderschiffes zunächst unversehrt blieb. Wenn man sich fragt, wann denn eine möglicherweise an Bord befindliche Bombe eigentlich hätte zünden sollen, so sollte man die Rückfahrt des LZ 129 nach Europa nicht außer Acht lassen, bei der ein Teil der angemeldeten Passagiere zu hochherrschaftlichen Feierlichkeiten nach London (Krönung von König George VI. am 12. Mai) reisen wollte (Toland 1989, S. 234 u. 263 f; Archbold 1994, S. 174, Sp. 2). Hierfür würde die Formulierung der Amerikanerin Kathie Rauch sprechen, welche von einer Fahrt „to another country" sprach (Archbold 1994, S. 172) und damit die USA als Ziel eigentlich ausschloß.
Als mögliche Attentäter kämen wahrscheinlich eher Unterstützer als Gegner des deutschen Regimes in Frage, zumal die führenden Nazis gemeinhin als Zeppelin-feindlich gesonnen gelten und bei den Luftschiffen vor allem auf Propaganda-Effekte abzielten; die Zerstörung des LZ 129 bedeutete immerhin eine über das Jahr 1936 hinausgehende Fortsetzung des finanziell bedingten Einflusses der Nationalsozialisten auf den Zeppelin-Konzern, während ihre außenpolitischen Ziele gleichfalls näherrückten. Man sollte auch berücksichtigen, daß das Lager der Nazi-Gegner in Deutschland im Jahr 1937 bereits ziemlich ausgedünnt war. Diesen Standpunkt vertrat zumindest Werner Maser (Das Regime. Alltag in Deutschland 1933 - 1945, Berlin 1990, ISBN 3-320-01732-2). Zwar klagten demnach „ungeduldige NS-Funktionäre, auch Mitte 1937 noch, daß es „,noch immer Marxisten' gebe, die ,das nationalsozialistische Deutschland' bekämpften" (ebd., S. 167), doch falle auf, daß es sich „bei den ,staatsfeindlichen Aktionen' zu dieser Zeit in der Regel lediglich um ,Maßnahmen' oder Äußerungen Einzelner handelte, die vorsichtig nach Kontakten mit Gleichgesinnten suchten und Nebensächlichkeiten hochspielten" (ebd.). Während die deutschen Machthaber „mit der Stimmung der Bevölkerung im Sommer 1937 durchaus zufrieden sein" konnten (ebd.), galt die Sorge der „Funkionsträger der NSDAP und des Regimes seit dem Spätjahr 1936" vielmehr zunehmenden Mängeln: „Es fehlten Rohstoffe und Arbeitskräfte." (ebd., S. 168). In diesem Umfeld dürfte eine Integration möglicher Gegner leichter gefallen sein als in den Anfangsjahren des Dritten Reichs, so daß sich der Staatsapparat mit seinen Terrorelementen auf Rohstoff-Beschaffung und Arbeiter-Mobilisierung ausrichten konnte.
4. Die unerwarteten Folgen für die Nazis
Kurz vor seinem Tod am 7. Mai soll Ernst Lehmann gegenüber Charles E. Rosendahl gefordert haben: „unabhängig von der Ursache muß das nächste Schiff Helium haben" (Toland 1989, S. 265; vgl. Archbold 1994, S. 199). In Deutschland herrschte eine Verbitterung darüber, daß die USA bislang kein Helium für Passagierfahrten bereitgestellt hatten (Toland 1989, S. 264). Noch am selben Tag verkündete der deutsche „Luftfahrt"-Minister Hermann Göring, daß er gleichwohl am Ausbau der deutschen Großluftschifffahrt festzuhalten gedenke: „Jetzt erst recht werden wir unter Verwertung der letzten Erfahrungen alles daran geben, den Luftverkehr zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten für immer und ungefährdet in die Tat umzusetzen." (Göring 1937, Sp. 3). Als Begründung für diese Unnachgiebigkeitserklärung nannte H. Göring sein „Vertrauen zu der so zahlreiche Male erprobten und bewährten Luftverbindung zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Volk" (ebd.). Spätestens hier fällt auf, daß der deutsche Luftwaffenchef ausschließlich die USA im Visier hatte, obwohl die Zeppeline ihren Ruhm vielmehr durch ihre Überseefahrten nach Südamerika erworben hatten. In einem Dankschreiben an den US-amerikanischen Präsidenten hob er die „selbstlose Art" hervor, in welcher „amerikanisches Fliegerpersonal den deutschen Kameraden zu Hilfe kam", und hielt dies beschwörend für einen „Beweis des Geistes, der die Flieger aller Nationalitäten vereint" (Zitat nach Toland 1989, S. 264). Diesbezüglich hat John Toland (ebd.) sicher recht, als er darauf hinwies, daß dieser angebliche Geist der Solidarität „bald ein jähes Ende finden" würde. Ärgerlich ist auch die Vereinnahmung des Luftschiffwesens - also der Luftfahrt im eigentlichen Wortsinn - durch die Fliegerei, denn Göring war ein klarer Vertreter des Prinzips Schwerer-als-Luft (Flugwesen), während die Luftschiffe seit dem Beginn ihrer Entwicklung das Prinzip Leichter-als-Luft (LTA-Technologie) vertreten und damit den gewöhnlichen Schiffen ähneln, welche auf dem Prinzip Leichter-als-Wasser beruhen.
Sicherlich wird angesichts der nationalsozialistischen Welteroberungspläne auch der deutschen Luftwaffe an einer guten Verbindung nach Amerika - hier wohl zunächst nach Nordamerika - gelegen gewesen sein, und diese konnte zu damaliger Zeit, wo Deutschland nicht einmal über weitreichende Bombenflugzeuge verfügte, allein mittels der Zeppeline aufrecht erhalten werden. Görings Hinweis auf das Postulat der Ungefährdetheit des Luftverkehrs beinhaltet nichts Anderes als sein Verlangen nach Helium; das geäußerte „Jetzt erst recht" darf man gerade auf die Forderung nach Lieferung dieses Edelgases beziehen; letztlich diente das Hochloben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Flieger-Kameradschaft mit den USA als das gerade jetzt so nötige Salz in der Suppe. Tatsächlich schien diese den Nordamerikanern zunächst zu schmecken, so daß von Seiten der Vereinigten Staaten unter hohen Kontrollauflagen die Lieferung von 300.000 Kubikmetern des kostbaren Stoffes zugesagt wurde (Botting 1993, S. 164). Dies hätte für LZ 127 und LZ 130 ausgereicht, nicht aber für den LZ 131. Daher kamen auch Kombinationslösungen ins Gespräch, bei denen beispielsweise Wasserstoff in eigenen Zellen von solchen mit Helium eingeschlossen worden wäre.
Nach dem Brand des LZ 129 hielt man am Bau von LZ 130 fest, und Hermann Göring tönte gleich am Folgetag: „Ich habe angeordnet, daß der Ausbau des in den Werkhallen in Friedrichshafen vor der Fertigstellung stehenden Luftschiffes [LZ 130 (D. R.)] beschleunigt durchgeführt wird. Es soll so schnell wie möglich als Ersatz ,LZ. Hindenburgs' Deutschlands stolze Flagge [das Hakenkreuz-Emblem der NSDAP (D. R.)] zeigen." (Göring 1937, Sp. 4)
Der LZ 127, dessen Bauweise ja keine Verwendung von Helium vorsah, sollte nach seiner Rückkehr aus Brasilien nicht mehr auf Fernreisen gehen; er wurde im Juni 1937 nach Frankfurt am Main überführt und danach als Museumsobjekt ausgestellt (Botting 1993, S. 164). Dieses Schiff - zweifellos Deutschlands bester Botschafter (wenn man nicht H. Eckener dafür in Anspruch nehmen möchte) - brachte es während seiner Einsatzzeit auf 1,7 Millionen Streckenkilometer, 590 Fahrten und 13.100 zahlende Passagiere (Bock et Knauer 2003, S. 355, Sp. 2). Im Vergleich zu den ersten Passagier-Zeppelinen war das - abgesehen von der Wegstrecke - kein großer Fortschritt, denn der LZ 11 „Viktoria-Louise" der DELAG hatte bereits vor dem Ersten Weltkrieg 9.738 Personen bei 489 Fahrten auf zusammen 54.300 Kilometern befördert (Wittemann 1925, S. 30).
Der LZ 130 blieb nach seiner Fertigstellung - trotz der gegenteiligen Ankündigung durch den „Luftfahrt"-Minister - zumindest zeitweise frei von auffälligen brandgefährdeten Hakenkreuzen (siehe die Farbfotos bei Archbold 1994, S. 206 f). Es blieb auch, und zwar hinsichtlich der Außenpolitik, ein schaler Beigeschmack in Görings amerikanischer Suppe, und dieser führte dann letztlich doch dazu, daß der Minister für „Alles, was fliegt" (zugleich Luftwaffenchef ) die Erfüllung seines Wunsches nie erleben sollte. Als der Österreicher Adolf Hitler nämlich im März 1938 sein Heimatland annektierte, weigerte sich der Innenminister der USA, Harold L. Ickes (zugleich Vorsitzender der nationalen Helium-Kommission), dann doch noch, Deutschland mit dem begehrten Gas zu versorgen. Er fürchtete - gewiß mit Recht -, daß Deutschland damit gefüllte Militärzeppeline einsetzen könnte (Botting 1993, S. 165 f; vgl. Archbold 1994, S. 205, Sp. 2 ). Solche, aus Vertretern des Ersten Weltkrieges weiterentwickelte Zeppelinbomber hätten es Hitler - vor der Entwicklung von Raketen und anderen Zutaten eines modernen Krieges - nach relativ kurzer Entwicklungszeit ermöglicht, das Binnenland der USA direkt anzugreifen, ohne daß diese so leicht in feurige Mahnmale zu verwandeln gewesen wären wie die Veteranen aus dem ersten Weltbrand! Auch eine Reise von Hugo Eckener zum Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerikas (Archbold 1994, S. 205 f) half nichts, war aber Anlaß für einen möglichen Sinneswandel zu Gunsten der Nazis bei Eckener selbst (vgl. Archbold 1994, S. 204 f); er vertrat zumindest die Auffassung, daß man dem Präsidenten Franklin Delano Roosevelt nicht trauen könne (siehe das Zitat bei Archbold 1994, S. 206, Sp. 1).
Der LZ 130 wurde erwartungsgemäß von der deutschen Luftwaffe übernommen (Botting 1993, S. 165); am 14. September 1938 startete er in Friedrichshafen zu seiner Jungfernfahrt unter dem Kommando von Hugo Eckener höchstpersönlich (Archbold 1994, S. 206). John Toland zufolge verliefen alle Testfahrten des LZ 130 erfolgreich, und er erwies sich „als das beste aller je gebauten Luftschiffe" (Toland 1989, S. 266). Der in Deutschland heimisch gewordene Diktator Adolf Hitler genehmigte jedoch nicht eine einzige Passagierfahrt mit ihm, angeblich um sich dadurch an Hugo Eckener zu rächen, „denn dieser hatte sich früher einmal geweigert, den Hangar in Friedrichshafen für ein Nazitreffen zur Verfügung zu stellen" (ebd.). Der Bau des LZ 131 wurde - als mit einer Helium-Lieferung nicht mehr zu rechnen war (auf eine solche hatte ein deutscher Frachter im Hafen von Galveston, Texas, vergeblich gewartet, siehe Archbold 1994, S. 205, Sp. 2) - nach der Erstellung erster Gerüstringe eingestellt (Archbold 1994, S. 208, Sp. 1).
Die führenden Nazis verlangten jetzt zunehmend, daß die mit Wasserstoff als Traggas versehenen Zeppeline zu aggressiven Zwecken zu verwenden seien; dies zeigte sich schon am 22. September 1938 bei einer angeblich zu Demonstrationszwecken nach Wien gehenden Reise des LZ 130, bei welcher es sich zweifellos um eine gegen die Tschechoslowakei gerichtete Spionage-Unternehmung handelte; der Zeppelin wurde dabei von vier (angeblich bloß Polizeiaufgaben dienenden) Kampfflugzeugen begleitet. Diese Lustfahrt stand letztmalig unter der offiziellen Leitung von H. Eckener (Archbold 1994, S. 206 f); anscheinend hatte sich diese ungebrochen populäre Persönlichkeit jetzt - so jedenfalls läßt zumindest das Schweigen zu dieser Fahrt in den Memoiren vermuten - mit dem Regime weitgehend arrangiert und trug nun mehr oder weniger bewußt zur Vertuschung des eigentlichen Zwecks der bis an die Grenzen gehenden Luftreise bei.
Im Mai und August 1939, also schon am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, fanden dann die beiden gegen Großbritannien gerichteten Spionagefahrten des letzten noch im aktiven Dienst befindlichen Zeppelins statt (Botting 1993, S. 165), welche selbstredend zu heftigen Protesten auf Seiten des angegriffenen Staates führten. Damals war noch nicht abzusehen, daß das ausgespähte Land einmal von diesem Gewaltakt profitieren sollte, denn die durch Großbritannien dank seines Radarsystems leicht zu beobachtenden Unternehmungen führten auf deutscher Seite zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen der Verteidigungsfähigkeit des potentiellen Kriegsgegners - das Frühwarnsystem wurde nämlich nicht als solches erkannt (Botting 1993, S. 165). Die technologische Luftschlacht um England verlor Deutschland somit schon vor dem Kriegsbeginn - mit seinem modernsten Zeppelin!
Voller Verdruß über die Verweigerung der Helium-Lieferung durch die noch nicht im Krieg stehenden USA - und wohl auch wegen der militärischen Mißerfolge der deutschen Luftschifffahrt - befahl schließlich Hermann Göring die Zerstörung der ihm verbliebenen Zeppeline LZ 127 und LZ 130 (also der beiden „Graf Zeppelin") im Februar 1940 (Botting 1993, S. 165); als die Zeppeliner zögerten, dieser unerhörten Forderung Genüge zu leisten (Archbold 1994, S. 208; vgl. auch den Hinweis auf eine Auseinandersetzung zwischen Hermann Göring und Max Pruß bei Toland 1989, S. 267) - wohl weil sie an eine Wiederaufnahme der Zeppelin-Fahrten nach Ende des Krieges glaubten -, setzten im März 1940 Angehörige der Luftwaffe den Befehl in die geforderte Fehlleistung um (Toland 1989, S. 267; Archbold 1994, S. 208). Die Ironie des Schicksals wollte es, daß nunmehr ausschließlich die USA im Besitz eines fahrtüchtigen Zeppelins waren, nämlich des Versuchsschiffes LZ 126 (ZR 3 „Los Angeles"), welches bekanntlich trotz der nicht dafür vorgesehenen Bauweise lange Zeit mit Helium gefahren wurde (Knäusel 1988, S. 35) und als Marineobjekt zeitweise sogar über ein eigenes Mutterschiff mit Ankermast verfügte (Bock et Knauer 2003, S. 335, Abb. 7.1.5). In Frankfurt am Main wurden schließlich - keineswegs zufällig am dritten Jahrestag der LZ-129-Verbrennung (6. Mai 1940) - auch die beiden bereits fertiggestellten Zeppelin-Betriebshallen mittels Sprengstoff vernichtet (Toland 1989, S. 267; Archbold 1994, S. 208, mit Farbfoto). Bei diesem Akt der Selbstzerstörung kam die deutsche Luftwaffe immerhin Angriffen allierter Bombenflugzeuge zuvor, welche bald das Kriegsgeschehen in Deutschland wesentlich beeinflussen sollten und stattdessen im Jahr 1944 die Zeppelin-Werft in Friedrichshafen zerstörten, wo bereits V2-Raketen gebaut wurden (Botting 1993, S. 165; Archbold 1994, S. 208).
Die deutsche LTA-Technologie genoß in den Vereinigten Staaten von Amerika, welche die Entwicklung eigener Gerüstluftschiffe - nach der sturmbedingten Zerstörung des ZR 1 „Shenandoah" (1925), dem Auseinanderbrechen des in England gebauten ZR 2 schon bei der Erprobung (vgl. Wittemann 1925, S. 34), sowie den Untergängen von ZR 4 „Akron" (1933) und ZR 5 „Macon" (1934) - trotz der Helium-Verwendung schon aufgegeben hatten, noch kurze Zeit eine höhere Wertschätzung als in deren Heimatland, auch wenn man die Versuche mit ZR 3 „Los Angeles" (LZ 126) inzwischen bis auf Weiteres eingestellt hatte. Schon in den Geburtswehen eines neuen Weltkrieges, als Kosten-, Rohstoff- und Technologie-Fragen auch in den USA zunehmend Bauchschmerzen bereiteten, wurde westlich des Atlantiks gleichfalls zum Schneidbrenner gegriffen, und damit fiel mit LZ 126 selbst der letzte Großzeuge einer viel zu stolzen Nation im August 1940 einem Wandel der Prioritäten zum Opfer (Meyer 1980, S. 117, Sp. 2). Das Fazit in dem Zeppelin-Buch von Peter Meyer lautet wohl mit Recht: „Das Luftschiff hatte sich als Verkehrsmittel des Friedens hervorragend bewährt; für eine Verwendung in einem modernen Krieg war es völlig ungeeignet." (Meyer 1980, S. 166, Sp. 2).
Wie immer man auch zu einer Beteiligung führender Nazis an der Vernichtung des LZ 129 - vier Jahre nach dem Reichstagsbrand und nur anderthalb vor der feurigen Progromnacht (der sogenannten „Reichskristallnacht") - stehen mag, so wird man doch nicht leugnen können, daß diese Herren - vor allem der für Luftfahrt und Flugwesen zuständige Reichsminister - für die Beseitigung der deutschen Zeppeline und deren zentraler Infrastruktur im Rahmen eines „Weltbrandes" verantwortlich zeichnen.
5. Ein Fazit
Seit dem Brand des LZ 129 sind zwei Drittel eines Jahrhunderts vergangen, mit einem Weltkrieg in dieser Zeit, der alles bis dahin Vorgefallene weit in den Schatten stellte. Es ist mittlerweile schwer geworden, noch Quellen zu finden, welche neue überzeugende Argumente zur Entstehung und Entwicklung des Feuers liefern könnten, dem der Zeppelin zum Opfer fiel. So bleibt vorerst - das heißt: vor eingehenderen Untersuchungen unter Ausnutzung der Digitaltechnik - nur zu sagen, daß die Annahme einer Sabotage mittels zeit- oder womöglich gar ferngesteuerter Zündvorrichtung an Bord zwar naheliegend ist, es aber demgegenüber wichtige Indizien für einen ungeplanten, chemophysikalisch erklärbaren Vorgang elektrischen Charakters gibt, welche eine höhere Gewalt sowie eine gewisse Unvorsichtigkeit bei der Materialauswahl und bei der Handhabung des Wasserstoffs als Ursachen in den Vordergrund rücken. Die - angesichts der Materialauswahl und der Maßnahmen beim Landemanöver - bestehende Möglichkeit eines Mitverschuldens der Deutschen Zeppelin-Reederei wurde seinerzeit verständlicherweise aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht öffentlich diskutiert (vgl. Bain et Schmidtchen 2000). Auch hier ist vielleicht nur ein Teil möglicher technischer Ursachen und Abläufe (wie etwa Wasserstoff-Lecks durch gerissene Drähte) überhaupt erfaßt worden.
Von der politischen Weltlage und Situation innerhalb des Staates her hätte sich ein von führenden Nazis in die Wege geleitetes und durch deutsche Geheimdienstler ausgearbeitetes, gegen die maßgeblichen Zeppeliner gerichtetes Sabotagevorhaben geradezu angeboten. Die Vertreter des Regimes vermochten im LZ 129 neben der Möglichkeit, Propaganda zu betreiben, keine weitere für sie in Friedenszeiten unmittelbar nützliche Funktion zu erkennen, welche die hohen Betriebs- und Entwicklungskosten gerechtfertigt hätten. Durch die Vernichtung eines bedeutenden Prestige-Objektes hätten sie dagegen einem der herausragendsten Kritiker ihres Regimes begegnen, einen der wichtigsten zukünftigen Kriegsgegner zur Herausgabe von kostbarem Helium motivieren und eventuell sogar Haß gegen angebliche Staatsfeinde schüren können.
Den größten Schaden des Brandes erlitt letztlich die deutsche Fliegerei- und Luftfahrtindustrie, und dieser Branche ist es - trotz sonstiger Überwindung der Folgen des Zweiten Weltkrieges - bis heute nicht annähernd gelungen, einen Ersatz für die Zeppeline zu schaffen. Wer sich beispielsweise als privater oder gar institutioneller Investor (egal aus welchem Winkel der Welt) für die CargoLifter AG stark macht, muß sogar - ganz anders als seinerzeit beim Grafen Zeppelin, welcher ja bei der Auflösung der „Gesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt" die Zeichner eines Garantiefonds entlohnte (Meyer 1980, S. 19, Sp. 2) - mit dem Gesamtverlust seines Investments rechnen. Damit schadet der Brand vom 6. Mai 1937 letztlich indirekt - nämlich durch die wohl darauf beruhende Verweigerung maßgeblicher öffentlicher Fördergelder - auch dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland - der zweiten deutschen Demokratie - als Entwicklungsland moderner mitteleuropäischer Technologie. Die mangelhafte Unterstützung ist ein Manko, das angesichts der Gelder, welche seinerzeit (selbst noch im Dritten Reich) der Zeppelin-Entwicklung zuflossen, eigentlich mehr als bloß Kopfschütteln hervorrufen sollte. Dabei ist zu berücksichtigen, daß gerade in jüngster Zeit die LTA-Technologie wieder vermehrt Aufmerksamkeit und Medienwirksamkeit verzeichnet (vgl. Bock et Knauer 2003). Die Hindenburg-Katastrophe droht nach allem in einer CargoLifter-Katastrophe zu enden.
Abschließend bleibt uns zum Luftschiff als Verkehrmittel nur übrig, zu wiederholen, was bereits John Toland anno 1978 (Toland 1989, S. 270) abschließend meinte:
(Wenn Sterne nur reden könnten!)
6. Mai 1937...
In fünf Teilen finden Sie dort zudem eine Sendung (aus der Reihe Menschen & Mächte) des Österreichischen Rundfunks (ORF) über die letzte Reise der ,Hindenburg':
Auch ,ZDF History' hat sich mit den deutschen Starrluftschiffen und der Explosion der ,Hindenburg' befaßt (YouTube-Video hochgeladen am 30.01.2014):
Weitere Videos zum 6.5.1937 lassen sich bei YouTube leicht finden, so daß hier nicht eigens darauf hingewiesen wird.
Archbold 1994: Rick Archbold (Text) u. Ken Marschall (Paintings), HINDENBURG - AN ILLUSTRATED HISTORY, New York 1994, ISBN 0-446-51784-4
Bain et Schmidtchen 2000: Addison Bain u. Ulrich Schmidtchen, Ein Mythos verglüht. Warum und wie die „Hindenburg" verbrannte, in: http://www.dwv-info.de/pm/hindbg/hbd.htm (DWV-Information Nr. 4 vom 18. Januar 2000, hg. vom Deutschen Wasserstoff-Verband e.V., Berlin)
Bock et Knauer 2003: Jürgen K. Bock u. Berthold Knauer, LEICHTER ALS LUFT. Transport- und Trägersysteme. BALLONE / LUFTSCHIFFE / PLATTFORMEN, Hildburghausen 2003, ISBN 3-86180-139-6 [Bezugsquelle]
Botting 1993: Douglas Botting u. die Redaktion der Time-Life-Bücher, DIE LUFTSCHIFFE, Eltville am Rhein 1993, ISBN 3-86047-057-4
Clausberg 1990: Karl Clausberg, ZEPPELIN: Die Geschichte eines unwahrscheinlichen Erfolges, München 1990, ISBN 3-89350-030-8
Eckener 1937: [Hugo] Eckener, Dr. Eckener über die Ursache des Unglücks. Gegen übereilige Urteile / Kommission nach USA abgereist, in: Westfälische Landeszeitung Rote Erde. Amtliches Blatt der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, 50. Jg., Folge 122, Ausgabe D (Bezirksausgabe Dortmund und Umgegend), Dortmund 1937 (8. Mai), S. 1, Sp. 1 - 3 [Institut für Zeitungsforschung Dortmund, Mikrofilm F7828]
Eckener et al. 1997: Eckener, Dürr, Breithaupt, Bock, Dieckmann u. Hoffmann, Die Katastrophe von Lakehurst 1937. Der deutsche Untersuchungsbericht. Bericht des deutschen Untersuchungsausschusses über das Unglück des Luftschiffes ,Hindenburg' am 6.5.1937 in Lakehurst, USA, vom 2.11.1937, in: Wolfgang Meighörner (Hg.), Giganten der Lüfte. Geschichte und Technik der Zeppeline in ausgewählten Berichten und zahlreichen Fotos. Mit einem aktuellen Beitrag über die Entwicklung des neuen Zeppelins, Luxembourg, 2. Aufl. 1997, S. 142 - 155, ISBN 3-89555-097-3 (Ein Auszug des Berichtes findet sich - als Reprint aus der Werkzeitschrift der Zeppelin-Betriebe, Ausgabe vom 1. März 1938 - auch bei Knäusel 1988, S. 81 - 99)
Geisenheyner 1997: Max Geisenheyner, Die Schlagzeile des Jahres 1929. Ein deutsches Luftschiff fährt um die Welt!, in: Wolfgang Meighörner (Hg.), Giganten der Lüfte. Geschichte und Technik der Zeppeline in ausgewählten Berichten und zahlreichen Fotos. Mit einem aktuellen Beitrag über die Entwicklung des neuen Zeppelins, Luxembourg, 2. Aufl. 1997, S. 94 - 123, ISBN 3-89555-097-3
Göring 1937: [Hermann] Göring, Beschleunigter Bau des neuen Luftschiffes. Aufruf Görings an die Männer der deutschen Luftfahrt, in: Westfälische Landeszeitung Rote Erde. Amtliches Blatt der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, 50. Jg., Folge 122, Ausgabe D (Bezirksausgabe Dortmund und Umgegend), Dortmund 1937 (8. Mai), S. 1, Sp. 2 - 4 [Institut für Zeitungsforschung Dortmund, Mikrofilm F7828]
Jäger 1956: Manfred Jäger, Hat das Luftschiff wieder Chancen?, in: hobby. Das Magazin der Technik, 4. Jg., Nr. 5, Stuttgart 1956 (Mai), S. 65 - 71 [Detlef Rothe privat]
Knäusel 1988: Hans G. Knäusel, Sackgasse am Himmel. Anmerkungen zur Luftschiffahrt damals und heute, Bonn 1988, ISBN 3-7812-1226-2
Koestler 1997: Arthur Koestler, Durchbruch in der Polarforschung. Die Expedition von 1931, in: Wolfgang Meighörner (Hg.), Giganten der Lüfte. Geschichte und Technik der Zeppeline in ausgewählten Berichten und zahlreichen Fotos. Mit einem aktuellen Beitrag über die Entwicklung des neuen Zeppelins, Luxembourg, 2. Aufl. 1997, S. 124 - 141, ISBN 3-89555-097-3
Marx 1959: E. Marx, Im Zeppelin über Länder und Meere. Ein postalisches Gedenken zum 120. Geburtstag des Grafen von Zeppelin, in: Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte e.V. (Hg.), ARCHIV FÜR DEUTSCHE POSTGESCHICHTE, Jg. 1959, 1. Heft, Frankfurt am Main o.J. [wohl vor dem 22. Mai 1959 erschienen], S. 34 - 37 und Farbtafeln S. 32/33 u. 40/41
Meyer 1980: Peter Meyer, Luftschiffe. Die Geschichte der deutschen Zeppeline, Koblenz u. Bonn 1980
N. N. 1937: N. N. [„eigener Bericht der WLZ"], Augenzeugen berichten... - Wie das Unglück des LZ "Hindenburg" geschah / Gerettete sagen: „Wir bleiben dem Luftschiff treu"!, in: Westfälische Landeszeitung Rote Erde. Amtliches Blatt der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, 50. Jg., Folge 122, Ausgabe D (Bezirksausgabe Dortmund und Umgegend), Dortmund 1937 (8. Mai), o. S.-Angabe, Sp. 1 - 3 [Institut für Zeitungsforschung Dortmund, Mikrofilm F7828, hier 3. Seite]
N. N. 1937 a: N. N. [Schriftleitung der WLZ], Ein Pionier der Luftschiffahrt. Zum Tod Kapitän Lehmanns / Der Führer zahlreicher Kriegsluftschiffe, in: Westfälische Landeszeitung Rote Erde. Amtliches Blatt der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, 50. Jg., Folge 123, Ausgabe D (Bezirksausgabe Dortmund und Umgegend), Dortmund 1937 (9. Mai), o. S.-Angabe, Sp. 3 - 4 [Institut für Zeitungsforschung Dortmund, Mikrofilm F7828, hier 2. Seite]
N. N. 1937 b: N. N. [„ek. Bielefeld"], Die Untersuchung in Lakehurst - Luftschiff "Hindenburg" nicht explodiert / Aussagen amerikanischer Luftschiff-Fachleute, in: Westfälische Landeszeitung Rote Erde. Amtliches Blatt der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, 50. Jg., Folge 124, Ausgabe D (Bezirksausgabe Dortmund und Umgegend), Dortmund 1937 (10. Mai), o. S.-Angabe, Sp. 4 - 5 [Institut für Zeitungsforschung Dortmund, Mikrofilm F7828, hier 9. Seite]
N. N. 1937 c: N. N. [„Eigener Bericht der WLZ"], Vom Schiffsjungen zum Luftschifführer. Kapitän Max Pruß - ein Bielefelder, in: Westfälische Landeszeitung Rote Erde. Amtliches Blatt der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei, 50. Jg., Folge 125, Dortmund 1937 (11. Mai), S. 1, Sp. 2 - 4 [Institut für Zeitungsforschung Dortmund, Mikrofilm F7828]
N. N. 1997: N. N. [„Hamburg (dpa)"], Ursache der Katastrophe nach 60 Jahren ungeklärt. Zeppelin Hindenburg explodierte: 36 Tote, in: Münstersche Zeitung. Westfalen-Anzeiger, 127. Jg., Nr. 104, Münster 1997 (5. Mai), S. vd1
Toland 1989: John Toland, Die große Zeit der Luftschiffe. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christiane Trabant-Rommel, Herrsching 1989, ISBN 3-88199-519-6
Treibel 1992: Werner Treibel, Geschichte der deutschen Verkehrsflughäfen. Eine Dokumentation von 1909 bis 1989, Bonn 1992, ISBN 3-7637-6101-2
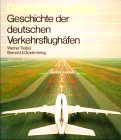
Wittemann 1925: A[nton] Wittemann, MIT DEM LUFTSCHIFF ÜBER DEN ATLANTISCHEN OZEAN. DIE AMERIKAFAHRT DES Z. R. III. DIE GESCHICHTE DES GESAMTEN ZEPPELINBAUES, Wiesbaden 1925 (Ein Auszug des Berichtes über die „Amerikafahrt" findet sich in: Wolfgang Meighörner (Hg.), Giganten der Lüfte. Geschichte und Technik der Zeppeline in ausgewählten Berichten und zahlreichen Fotos. Mit einem aktuellen Beitrag über die Entwicklung des neuen Zeppelins, Luxembourg, 2. Aufl. 1997, S. 52 - 59, ISBN 3-89555-097-4)
Der Verfasser (im Text: D. R.) dankt dem Institut für Zeitungsforschung zu Dortmund für die Bereitstellung von Zeitungen und Mikrofilmen, der Universitäts- und Landesbibliothek zu Münster für die Bereitstellung von Literatur und Arbeitsplätzen, sowie den Forumsteilnehmern der Initiative Zukunft in Brand für Hinweise auf Internet-Adressen!
Interessante Links:
Liste der Zeppeline
Wikipedia-Artikel zum LZ 127 „Graf Zeppelin"
Wikipedia-Artikel zum LZ 129 „Hindenburg"
Details zum LZ 129 im Aeronauticum Nordholz
Blau-Rot-Stereobilder, darunter der LZ 129 mit dem Empire State Building zu New York
Die Erfolgszeit der Luftschiffe und ihr abruptes Ende
Bilder aus dem Luftschiff LZ 129, dazu eine Ansicht vom Brandausbruch
"Was ist was?" über die Hindenburg-Katastrophe
The Hindenburg Mystery
Foto-Seite der Navy Lakehurst Historical Society zum LZ 129
Description of Hindenburg Crash (NAVAIR Lakehurst)
Hydrogen Didn’t Cause Hindenburg Fire, said William D. Van Vorst
Hydrogen Exonerated in Hindenburg Disaster
Der Flugsport-Club Neumünster über die Hindenburg-Katastrophe
Besuch des überlebenden Offiziers Boetius im Zeppelin-Museum Tondern
Zeppelin-Museum in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main

5. Dimension
Arbeitswelt
Archäologie
Biographie
Gesundheit
Impressum
Neuigkeiten
Regionales
Reisen
Verkehr